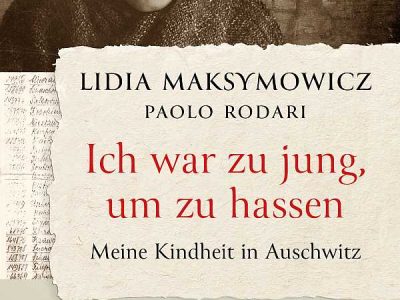Die Mythologie der Germanen
Einleitung
Die wichtigsten Überlieferungen über die Mythologie der germanischen Stämme stellen die nordische Edda und andere Saga dar und die Schriften, die uns die Römer hinterlassen haben. Zu beachten ist dabei, daß es sich bei den Mythologien der Germanen nicht um eine einheitliche Vorstellungswelt handelt, sondern es gab vielmehr mehrere Kulturkreise, die ihre eigene Mythologie entwickelten. Teilweise gab es auch einzelne Stämme mit ihrer eigenen Mythologie und Götterwelt, was uns heute die Betrachtung derselben erschwert. Auch haben uns besonders die Kontinental-Germanen über ihre Glaubensvorstellungen kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen – woran sie glaubten, haben sie ausschließlich mündlich an die jeweils nächste Generation weitergegeben. Diese Form der Weitergabe ist natürlich besonders starken Veränderungen unterworfen, weil Erzählungen aus dem Gedächtnis naturgemäß immer Einflüssen, z. B. von aktuellen Ereignissen, die eventuell mit eingebaut werden, ausgesetzt sind oder mit der Zeit in Vergessenheit geraten können.
Somit können die uns erhaltenen schriftlichen Überlieferungen nur punktuell aufzeigen, woran der eine oder andere Stamm oder Kulturkreis glaubte. Besonders interessant, aber auch unbedingt zu berücksichtigen ist dabei, daß selbst die uns überlieferten Namen von Gottheiten im Laufe der Zeit sprachlichen Veränderungen unterlagen. (Mehr dazu in der Rubrik – Gottheiten der Germanen)
Über die mythologische Abstammung der Germanen hat uns der Römer Tacitus im 1. Jh. n. Chr. folgendes überliefert:
„Die Germanen preisen in uralten Liedern, der einzigen Art von geschichtlicher Überlieferung, die es bei ihnen gibt, den erdentsprossenen Gott Tuisto. Ihm weisen sie einen Sohn Mannus als den Urahn und Stammesvater ihres Volkes zu, dem Mannus (wiederum) drei Söhne, nach deren Namen die unmittelbar an der Küste des Ozeans lebenden Stämme Ingävonen (von Ingwaz), die Völker in der Mitte des Landes Herminonen, die Übrigen Istävonen heißen sollen. Manche behaupten, wie es bei einer so weit zurückliegenden Zeit leicht zu vertreten ist, der Gott habe mehr Söhne gehabt und es gebe (entsprechend) mehr Stammesnamen – Marser, Gambrivier, Sueben, Vandilier -, und dies seien die echten, alten Namen.“
(nach A. Mauersberger 1971, S.27, s. Tacitus)
Diese Mannussage oder Mannuslied war, wie die meisten mündlichen Überlieferungen, in Stabreimen abgefaßt und kann, auf Grund sprachlicher Veränderungen, in der Form in der sie Tacitus beschrieb, nicht weiter als bis ins 1. Jh. v. Chr. zurückreichen. Mehrere Wissenschaftler haben aber auch darauf aufmerksam gemacht, daß es ganz ähnliche Entstehungsmythen besonders bei den Skythen, aber auch bei anderen indoeuropäischen/indogermanischen Völkern gab. So wird angenommen, daß die Legende an sich durchaus viel älter sein könnte und einen gesamt-indoeuropäischen/indogermanischen Ursprung haben könnte, so daß Tacitus zu recht von uralten Liedern schrieb. Daß diese Überlieferung auch noch sehr lange Zeit erhalten blieb, zeigt sich deutlich an einer fränkischen Völkertafel aus dem 7./ 8. Jh. n. Chr., auf der von den drei Brüdern Istio, Ingno und Erminus verschiedene Völkerschaften abgeleitet werden.
Den besten Überblick, welche Vorstellungen die Germanen im Norden über den Anfang aller Dinge und über die Götter hatten, gibt uns die Edda. Man nimmt allgemein an, Edda war das Synonym für Großmutter, denn auch in Rigsmal – Das Lied von Rigr kommt der Name Edda vor und ist danach die Großmutter der Knechte Geschlecht (siehe: Rigsmal – Das Lied von Rigr). Die Edda stellt die älteste schriftliche Überlieferung der nordischen Stämme über ihre Mythen und Glaubensvorstellungen dar. Man unterscheidet dabei zwischen jüngerer und älterer Edda, da sie jeweils zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben wurden. Die Lieder der älteren Edda entstanden zwischen 800 und 1200 im gesamten nordischen Raum, die ersten in Norwegen oder auf den kolonisierten Inseln und die späteren in Island, das jüngere Atli-Lied auf Grönland. Es wird allgemein angenommen, daß diese Lieder sehr alte Überlieferungen darstellen, was auch aus der Völuspa – der Seherin Weissagung als Einleitung hervorgeht:
„1) Allen Edlen gebiet ich Andacht,
Hohen und Niedern von Heimdalls Geschlecht;
Ich will Walvaters Wirken künden,
Die ältesten Sagen, der ich mich entsinne.“
Die Jüngere Edda entstand um 1220 in Island – ihr Verfasser ist Snorri Sturluson (geb. 1178, ermordet 22.9.1241). Er vermittelte die Regeln skaldischer Dichtung, vor allem aber schuf er eine umfassende Darstellung der altnordischen Mythologie in dem Werk Gylfaginning – Gylfis Verblendung oder Täuschung. Dieses Werk stellt eine etwas weiter ausgeschmückte Zusammenfassung der älteren Edda dar. Zu bedenken ist besonders bei der jüngeren Edda jedoch, daß sie geschrieben wurde, als sich Island bereits über 200 Jahre lang zum Christentum bekannte und das Werk deshalb bereits christliche Einflüsse enthalten könnte.
Sagen und Lieder um Götter und Helden
Im Folgenden eine Übersicht:
Ältere Edda:
Völuspa – Der Seherin Weissagung
Grimnismal – Das Lied von Grimnir
Vafthrudnismal – Das Lied von Wafthrudnir
Hrafnagaldr Odins – Odins Rabenzauber
Vegtamskvida – Das Wegtamslied
Havamal – Des Hohen Lied
Loddfafnirs-Lied
Odins Runenlied
Harbardsliod – Das Harbardslied
Hymiskvida – Die Sage von Hymir
Ögisdrecka – Ögirs Trinkgelag
Thrymskvida oder Hamarsheimt
Thryms-Sage oder des Hammers Heimholung
Alvissmal – Das Lied von Alwis
Skirnisför – Skirnirs Fahrt
Grogaldr – Groas Erweckung
Fiölsvinsmal – Das Lied von Fiölswinn
Rigsmal – Das Lied von Rigr
Hyndluliod – Das Hyndlalied
Völundarkvida – Das Lied von Wölund
————————————–
Jüngere Edda:
Gylfaginning – Gylfis Verblendung
Bragaroedur – Bragis Gespräche mit Ögir
Thors und Hrungnirs Kampf
Thors Fahrt nach Geirrödsgard
Lokis Wette mit den Zwergen
Menja und Fenja + Grotta songr – Das Grottenlied
Hrolf Kraki
Högni und Hilde
Die Niflungen und Giukungen
————————————–
Heldensagen:
Helgakvida Hjörvardssonar – Das Lied von Helgi dem Sohne Hiörwards
Helgakvida Hundingsbana in fyrri – Das erste Lied von Helgi dem Hundingstöter
Helgakvida Hundingsbana önnur – Das andere Lied von Helgi dem Hundingstöter
Sinfiötlalok – Sinfiötlis Ende
Sigurdharkvida Fafnisbana fyrsta edha Grîpisspâ – Das erste Lied von Sigurd dem Fafnirstöter oder Gripirs Weissagung
Sigurdharkvida Fafnisbana önnur – Das andere Lied von Sigurd dem Fafnirstöter
Fafnismal – Das Lied von Fafnir
Sigrdrifumal – Das Lied von Sigdrifa
Brot af Brynhildarkvidu – Bruchstück eines Brünhildenliedes
Sigurdarkvida Fafnisbana thridja – Das dritte Lied von Sigurd dem Fafnirstöter
Helreidh Brynhildar – Brünhildens Todesfahrt
Gudrunarkvida fyrsta – Das erste Gudrunenlied
Drap Niflunga – Mord der Niflunge
Gudrunarkvida önnur – Das andere Gudrunenlied
Gudrunarkvida thridja – Das dritte Gudrunenlied
Oddrunargratr – Oddruns Klage
Atlakvida – Die Sage von Atli
Atlamal in Groenlenzku – Das Lied von Atli
————————————–
Gunnars Harfenschlag
————————————–
Gudrunarhvot – Gudruns Aufreizung
Hamdismal – Das Lied von Hamdir
————————————–
Hervararsaga – Die Saga von Hervor
Ynglinga saga
—————————————
Die Merseburger Zaubersprüche
=======================