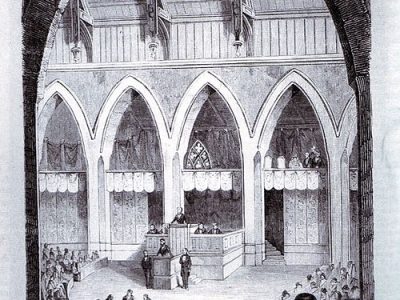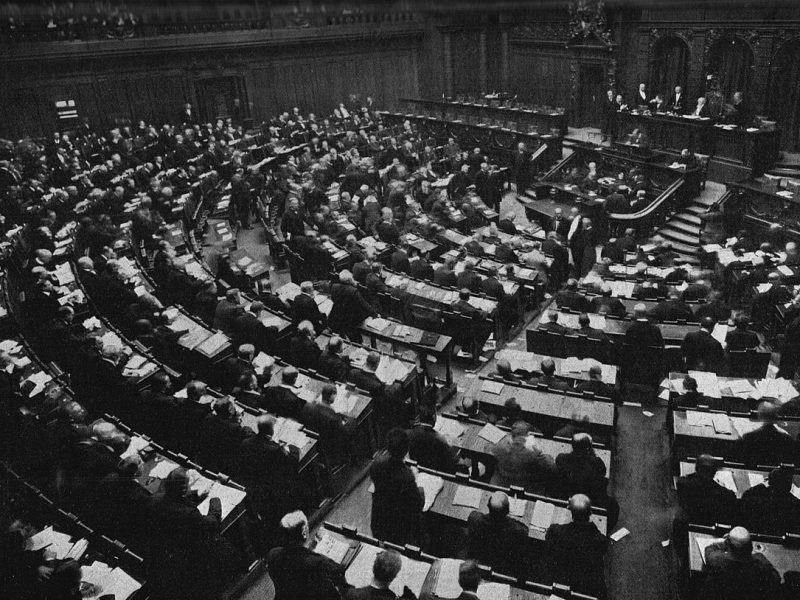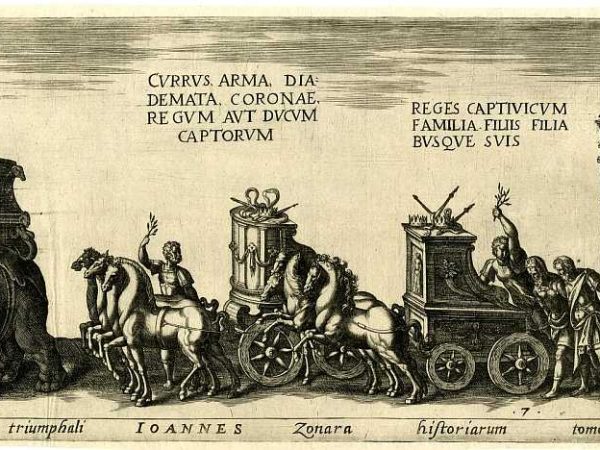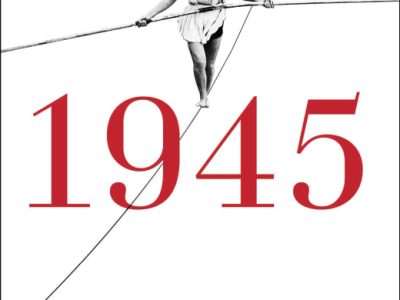Vorspiel
Der zweite Juni 1967
Berlin, 2. Juni 1967: Der Unmut und die Unzufriedenheit der Studenten, die in den Sechzigerjahren immer mehr gewachsen war, erreichte seinen Höhepunkt, als Reza Pahlevi, der Schah von Persien, auf Staatsbesuch nach Deutschland kam. In der offiziellen Einladung von Pahlevi, der seit 1953 mit Unterstützung der USA im Iran eine Militärdiktatur errichtet hatte, glaubten viele der jungen Menschen, die schon durch Proteste gegen den Vietnamkrieg, veraltete Lehrmethoden und allgemein die „kapitalistische Ausbeutungsmaschinerie“ geeint waren, erkennen zu können, wie es in Wahrheit mit der Demokratie in Deutschland bestellt sei.
In ihren Augen hatte die Bundesrepublik durch die Maßnahmen im Vorfeld des Schah-Besuchs ihr wahres, polizeistaatliches Gesicht offenbart: Autobahnen, die der Konvoi des Schahs befahren sollte, wurden komplett gesperrt. In Deutschland lebende Perser, von denen bekannt war, dass sie mit der politischen Linie Pahlevis nicht einverstanden waren, wurde ohne jegliche Rechtsgrundlage in Vorbeugehaft genommen, während die so genannten Jubelperser – wie später bekannt wurde großteils Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes SAVAK – ihren Schah jubelnd und mit Fahnen winkend am Flughafen begrüßen durften.
Als Studenten später am Tag vor dem Schöneberger Rathaus protestierten, in das der Schah sich begeben hatte, um sich im Goldenen Buch der Stadt einzutragen, begannen die Jubelperser, mit Holzlatten auf die Deutschen einzuprügeln. Die Polizei griff erst Minuten später ein – auf Seiten der Perser. Als der Schah am Abend die Deutsche Oper besuchte folgte dasselbe Schauspiel: Jubelperser und Polizei gingen brutal gegen die Demonstranten vor.
Der Polizist Karl-Heinz Kurras und seine Kollegen glaubten, einen der Rädelsführer der Proteste ausfindig gemacht zu haben und verfolgten ihn. Plötzlich löste sich ein Schuss, die Kugel traf den Kopf des Demonstranten. Benno Ohnesorg, 26 Jahre alt und an diesem Abend zum ersten Mal auf einer Demonstration, starb kurz darauf auf dem Weg ins Krankenhaus. Das gewaltsame Vorgehen der Polizei hat ein erstes Menschenleben gekostet.
Noch in der Nacht erklärt der Regierende Bürgermeister, Heinrich Albertz von der SPD: „Die Studenten haben […] nicht nur einen Gast der Bundesrepublik Deutschland beschimpft und beleidigt […], sondern auf ihr Konto gehen auch ein Toter und zahlreiche Verletzte.“
Kurras, der Todesschütze, wurde später freigesprochen. Es habe sich um Putativnotwehr gehandelt, so die Begründung des Gerichts. Reue empfand er nicht. Im Jahr 2007 äußerte er sich gegenüber der Presse wie folgt: „Wer mich angreift, wird vernichtet. Aus. Feierabend. So is das zu sehen.“
Später berichtet Albertz über die Reaktion Pahlevis: „Am nächsten Morgen musste ich den Schah zum Flugzeug bringen. Ich fragte ihn, ob er von dem Toten gehört habe. Ja, das solle mich nicht beeindrucken, das geschehe im Iran jeden Tag.“
Die Folgen
Benno Ohnesorgs Tod blieb nicht folgenlos: Das Westberliner Abgeordnetenhaus setzte einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein, dessen Abschlussbericht einige Rücktritte und Suspendierungen nach sich zog.
Viel entscheidender waren jedoch die Konsequenzen, die die Studentenbewegung aus dem Tod Ohnesorgs zog: Der brutale und rücksichtslose Polizeieinsatz während des Schahbesuchs war für die meisten ein eindeutiges Zeichen für die Gewaltbereitschaft des Staates gegenüber Kritikern der Regierung. Das führte zu einer zunehmenden Radikalisierung der APO (Außerparlamentarische Opposition) und zur These: „Gewalt kann nur mit Gewalt bekämpft werden.“ Gudrun Ensslin äußerte sich noch am selben Abend im SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) wie folgt: „Dieser faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten. Wir müssen Widerstand organisieren. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden. Dies ist die Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren.“
So ist kaum zu bestreiten, dass der Tod Benno Ohnesorgs für viele der entscheidende Anlass war, in den Untergrund und die Illegalität zu gehen und so überhaupt erst der Grundstein für den westdeutschen Terrorismus in den folgenden Jahren gelegt wurde.
Hauptteil
In jenem politisch heißen Sommer trafen sich auch zwei Menschen zum ersten Mal, die später die Köpfe der Roten Armee Fraktion bilden sollten: Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Schon an diesem ersten Abend in der Wohnung Bernward Vespers – Ensslins Verlobtem – wurden Pläne für politische Aktionen als Antwort auf die Vorfälle im Juni geschmiedet; die Ideen, die Baader – der bereits zu dieser Zeit einen gewissen Ruf in der Berliner Szene hatte – einbrachte, waren die mit Abstand radikalsten.
Andreas Baader
Bernd Andreas Baader wurde am 6. Mai 1943 in München geboren. Sein Vater, der Historiker Dr. Berndt Phillipp Baader blieb vermisst, nachdem er 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet, und so wird Baader in einem reinen Frauenhaushalt von seiner Mutter, seiner Großmutter und seiner Tante erzogen.
Als Jugendlicher fiel er besonders durch die ihm attestierte hohe Intelligenz sowie seine beständige Weigerung, sich einer Autorität zu beugen, auf. Er zeigte ein hohes Aggressionspotential und prügelte sich oft; mehrmals wurde er der Schule verwiesen.
Später entdeckte er seine Liebe zu Automobilen und Motorrädern – derer machte er sich des Öfteren durch Diebstahl habhaft. Mehrere Gefängnisstrafen saß er wegen Verkehrsdelikten, insbesondere Fahren ohne Führerschein, ab. 1963, als er zwanzig Jahre alt war, zog er nach West-Berlin. Dort lernte er Ellinor Michel und Manfred Henkel, ein Ehepaar, das mit dem gemeinsamen Sohn in Schöneberg lebt, kennen. Man verstand sich, Baader zog zu ihnen und man lebte in einer Art Dreiecksbeziehung. 1965 brachte „Ello“ Baaders Tochter Suse zur Welt.
Gudrun Ensslin
Gudrun Ensslin wurde am 15. August 1940 als viertes von insgesamt sieben Kindern des evangelischen Pfarrers Helmut Ensslin, der während des Krieges der Bekennenden Kirche angehörte, und seiner Frau Ilse Ensslin im schwäbischen Bartholomä geboren. Im Jahr 1960 machte sie ihr Abitur in Tuttlingen, wo sie das Gymnasium besuchte, und begann im selben Jahr in Tübingen ein Germanistikstudium. Zwei Jahre später, 1962, lernte sie Bernward Vesper, den Sohn des Schriftstellers Will Vesper, kennen, der ebenfalls Germanistik studierte. Sie verlobten sich; im Jahr darauf gründeten sie zusammen einen Verlag, das „Studio für neue Literatur“. Am 13. Mai 1967 kam der gemeinsame Sohn Felix zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt drohte die Beziehung jedoch schon zu zerbrechen; Ensslin weigerte sich, Vesper zu heiraten. Im Januar des Folgejahres trennten sie sich endgültig, wahrscheinlich weil Ensslin die Launenhaftigkeit ihres Verlobten nicht länger ertrug.
Den Ausschlag zum ersten ernsthaften Verbrechen der beiden gab eine Flugschrift der Kommune I. Diese hatte nach dem Brand im Brüsseler Warenhaus „À L’Innovation“ am 22. Mai 1967, bei dem mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen waren, mehrere Flugblätter veröffentlicht, auf dem sie – nach Meinung des Gerichts, vor dem sich die Kommunarden Rainer Langhans und Fritz Teufel wegen eben jener Flugblätter zu verantworten hatten – zur Brandstiftung aufriefen. Die Aussage „Ein brennendes Kaufhaus mit brennenden Menschen vermittelte zum ersten Mal in einer europäischen Hauptstadt jenes knisternde Vietnamgefühl (dabei zu sein und mit zu brennen), das wir in Berlin bisher noch missen müssen“ brachte den Bezug zum Vietnamkrieg, gegen den sich damals die Mehrheit der Studentenproteste richteten. So entstand schließlich der Eindruck, die Gewalt in Südostasien sei nur durch Gegengewalt zu beenden. Und die Frage „Wann brennen die Berliner Kaufhäuser“ lieferte auch gleich die Antwort auf die Frage, wie diese Gegengewalt denn aussehen müsste.
Im März 1968 entstand der Entschluss, dass sie – gemeinsam mit Thorwald Proll, einem Freund der beiden – ein wenig in westdeutschen Kaufhäusern „zündeln“ wollten. In München besorgten sie sich bei Horst Söhnlein, einem altem Bekannten von Andreas Baader, die Materialien, die sie für ihre Brandsätze benötigen und fuhren dann nach Frankfurt am Main. Das war am 2. April 1968. Am Abend, kurz vor Ladenschluss, begaben sich Baader und Ensslin gemeinsam in das „Kaufhaus Schneider“ und deponierten dort in einem Moment, da sie sich unbeobachtet fühlen, einen Brandsatz auf einer Schrankwand. Der Zeitzünder stand auf Mitternacht, damit das Feuer zu einer Zeit ausbrach, in der keine Menschen verletzt werden konnten. Zur selben Zeit wurde auch im „Kaufhof“ ein Brandsatz gelegt; wer hier die Täter waren, konnte später nicht eindeutig geklärt werden.
Kurz vor Mitternacht rief eine Frau im Büro der Deutschen Presseagentur an und saget: „Gleich brennt’s bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt.“ Und tatsächlich brannten in dieser Nacht zwei Kaufhäuser in Berlin. Die Feuerwehr war jedoch schnell zur Stelle und die – relativ geringen – Schäden, die entstanden, sind hauptsächlich durch Löschwasser und nicht durch das Feuer selbst verursacht worden.
In jener Nacht kamen die Brandstifter bei einer Bekannten unter, die sie im „Club Voltaire“ kennen gelernt hatten. Doch dem Freund der Bekannten behagte der Besuch nicht; er hatte ihn von Anfang an im Verdacht, hinter den Bränden zu stecken.
Am nächsten Morgen wurden Baader, Ensslin und die anderen aufgrund eines „konkreten Hinweises“ von der Polizei verhaftet. In Ensslins Tasche wurde eine Schraube gefunden, wie sie auch bei den Brandsätzen verwendet worden war; im Auto wurden noch weitere zum Bau eines Sprengsatzes geeignete Materialien sichergestellt.
Während die Brandstifter in Untersuchungshaft saßen, kamen sie erstmals mit Ulrike Meinhof in Kontakt. Meinhof arbeitete zu diesem Zeitpunkt noch als Kolumnistin für „konkret“ und wollte Ensslin für einen Artikel interviewen. In diesem Artikel zog Meinhof, die sich von Ensslin tief beeindruckt zeigte, auch gleich das Fazit der Brandanschläge: „So gesehen ist Warenhausbrandstiftung keine antikapitalistische Aktion, eher systemerhaltend, konterrevolutionär.“
Am 31. Oktober 1968 wurden die Urteile im so genannten „Brandstifter-Prozess“ verlesen: Drei Jahre Gefängnis für jeden der Angeklagten. Doch bereits am 13. Juni 1969 befanden sich Baader, Ensslin, Proll und der mitangeklagte Söhnlein wieder auf freiem Fuß; im November sollte darüber entschieden werden, ob der Revision der Urteile stattgegeben wird. Es wurde nicht. Nachdem sie die Zeit bis November in Frankfurt verbracht hatten, flohen die Brandstifter nach Frankreich, nur Söhnlein trat die Haft an. In Paris lebten Baader, Ensslin, Thorwald Proll und dessen Schwester Astrid in der Wohnung des französischen Schriftstellers Régis Debray, der als Kampfgenosse Che Guevaras 1967 in Bolivien festgenommen und zu dreißig Jahren Haft verurteilt worden war. Nachdem die Flüchtigen sich in Amsterdam neue Papiere beschafft hatten, reisten sie weiter nach Italien, wobei sie in Straßburg Thorwald Proll abhängten, da dieser nach Baaders Meinung nicht robust genug für ein Leben im Untergrund war. Proll stellte sich später den Behörden und trat den Rest seiner Haftstrafe an. Baader, Ensslin sowie Astrid Proll kehrten Anfang des Jahres 1970 nach Deutschland zurück.
Ulrike Meinhof
Ulrike Marie Meinhof wurde am 7. Oktober 1934 in Oldenburg geboren, zog jedoch schon früh nach Jena. Ihr Vater war der Kunsthistoriker Dr. Werner Meinhof, der im Jahre 1940 an Krebs verstarb. Über ihre Mutter, die ein Kunststudium begann, lernte sie Renate Riemeck kennen. Nach dem Tod der Mutter Ingeborg Meinhof 1948 übernahm Riemeck auch die Vormundschaft für Ulrike und deren ältere Schwester Wienke.
Nach dem bestandenen Abitur 1955 begann sie ein Studium der Philosophie, Pädagogik, Soziologie und Germanistik in Marburg, wechselte jedoch 1957 nach Münster, wo sie sich dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) anschloss. Sie engagierte sich in der Friedensbewegung, die sich gegen eine Bewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen aussprach.
Im Jahre 1958 trat sie der bereits 1956 verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei. 1959 erschien ihre erste Kolumne bei »konkret«, einer Hamburger Kulturzeitung, deren Chefredakteur Klaus Rainer Röhl sie während ihres Engagements gegen Atomwaffen kennen gelernt hatte. Im Januar des Folgejahres wurde sie selbst Chefredakteurin von »konkret«; am 27.12.1961 heiratete sie Röhl.
Einen Rechtsstreit mit dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, der sich von ihr mit Adolf Hitler verglichen sah, gewann sie mit der Hilfe ihres Verteidigers, des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, und erlangte so in Deutschland eine gewisse Popularität.
1962 brachte sie die Zwillinge Bettina und Regine zur Welt. Nachdem die aus der DDR agierende KPD 1964 die finanzielle Unterstützung für »konkret« versagte, beendete sie ihre redaktionelle Mitarbeit und schrieb fortan nur noch Kolumnen. 1968 folgte die Scheidung von Klaus Rainer Röhl, 1969 beendete sie ihre Mitarbeit an »konkret« schließlich ganz. In der Frankfurter Rundschau schrieb sie: „Ich stelle meine Mitarbeit jetzt ein, weil das Blatt im Begriff ist, ein Instrument der Konterrevolution zu werden, was ich durch meine Mitarbeit nicht verschleiern will.“
Meinhof konzentrierte sich nun ganz auf die Arbeit an „Bambule“, ihrem ersten Fernsehspiel, das die autoritären Methoden der Heimerziehung kritisierte. Sie wurde dabei zusehends depressiver und fragte sich nach dem Sinn ihres Tuns, als plötzlich zwei wohlbekannte Gestalten an ihrer Tür auftauchten und um Unterschlupf baten.
Es war im Februar des Jahres 1970, als Andreas Baader und Gudrun Ensslin bei Ulrike Meinhof klingelten. Man kannte sich bereits vom Brandstifter-Prozess, und Meinhof erklärte sich einverstanden, den beiden, die immer noch von der Polizei gesucht wurden, Unterschlupf zu gewähren. Baader und Ensslin blieben jedoch nur wenige Wochen und zogen dann zusammen mit dem Rechtsanwalt Horst Mahler in eine eigene Wohnung. Genaue Pläne, was sie nun tun wollten, hatten sie nicht. Irgendwann entstand die Idee, dass man Waffen brauche und so versuchten sie, sich welche zu beschaffen. Peter Urbach, ein in der Szene aktiver V-Mann und Agent des Verfassungsschutzes, gab ihnen Tipps. Bei dem Versuch, eines der von Urbach beschriebenen Waffenverstecke aufzusuchen, gerieten sie in eine fingierte Verkehrskontrolle und Andreas Baader wurde festgenommen.
Unverzüglich kam der Wille auf, Baader zu befreien. Man schmiedete Pläne, besorgte sich Waffen im rechtsradikalen Milieu und schließlich war es so weit:
Der 14. Mai 1970 – Die Baader-Befreiung
Am Morgen des 14. Mai 1970 wurde Andreas Baader aus der JVA Tegel, in der er seine Reststrafe wegen Brandstiftung verbüßte, in das „Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen“ ausgeführt. Dort sollte er Ulrike Meinhof treffen, die vorgab, gemeinsam mit Baader ein Buch über die Organisation randständiger Jugendlicher schreiben zu wollen. Während die beiden im Lesesaal des Instituts vortäuschten, an ihrem Buch zu arbeiten, klingelten zwei Frauen, die später von der Polizei als Ingrid Schubert und Irene Goergens identifiziert wurden, an der Tür des Instituts und wurden eingelassen, durften den Lesesaal aber nicht betreten und warteten in der Eingangshalle. Plötzlich öffneten sie die Tür und zwei vermummte und bewaffnete Gestalten stürmten in das Institut. Ein Schuss fiel und traf den Institutsangestellten Georg Linke.
Nachdem die Eindringlinge die Polizisten, die Baader bewachen sollten, mit Schüssen aus ihren Tränengaspistolen handlungsunfähig gemacht hatten, flüchteten Baader, Meinhof, Goergens, Schubert und die beiden Unbekannten durch das Fenster und rauschten in zwei Autos davon. Nach mehreren Fahrzeugwechseln verlor die Polizei die Spur der Gruppe, die sich nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in der Wohnung einer Bekannten von Ulrike Meinhof versteckte. Am Abend feierte man in einer Berliner Hinterhof-Wohnung die geglückte Befreiung.
Es entstand die Idee, sich nach Jordanien in ein Übungslager der palästinensischen Fatah zu begeben, um sich dort militärisch ausbilden zu lassen. Kurz vor ihrer Abreise ließ die Gruppe der französischen Journalistin Michele Ray ein Tonband zukommen, in der sie ihre Gründe für die Baader-Befreiung darlegte. Der SPIEGEL veröffentlichte später Auszüge daraus. So gab es laut Meinhof im Wesentlichen drei Gründe für die Befreiungsaktion:
- Baader ist ein Kader und als solcher unentbehrlich für die Gruppe.
- Eventuelle Sympathisanten der Gruppe können sich mit den Motiven einer Gefangenenbefreiung identifizieren.
- Die Gruppe macht klar, dass sie es ernst meint.
Jene Befreiung von Andreas Baader am 14. Mai 1970 wird heute üblicherweise als Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion – kurz RAF – angesehen.
Das Leben in der Illegalität
Die Idee, sich von der Fatah militärisch ausbilden zu lassen, wurde kurz darauf Realität. Etwa ein Monat nach der Baader-Befreiung, die für die meisten Gruppenmitglieder den endgültigen Schritt in die Illegalität bedeutet hatte, reiste man in zwei Gruppen über die DDR, den Libanon und Syrien nach Jordanien. Während des Trainings in einem Gebirgscamp nahe Amman wurden der Umgang mit Schusswaffen und verschiedene Szenarien wie zum Beispiel Banküberfälle geprobt.
Zurück in der Bundesrepublik wurden diese neu gewonnenen Fähigkeiten sogleich dem Praxistest unterzogen: Am 29. September 1970 wurden im Zuge des so genannten „Dreierschlages“ drei Banken in Berlin gleichzeitig überfallen. Die Beute betrug rund 200.000 Mark. Aufgrund eines anonymen Tipps gelang es der Westberliner Polizei kurz darauf Horst Mahler sowie die an der Baader-Befreiung beteiligten Ingrid Schubert und Irene Goergens zu verhaften.
Im weiteren Jahresverlauf konzentrierte sich die Gruppe auf Dokumentendiebstähle, um Ausweispapiere fälschen zu können und darauf, neue Mitglieder anzuwerben. In dieser Zeit stieß auch Jan-Carl Raspe dazu, der über seine Freundin Marianne, eine alte Bekannte Ulrike Meinhofs, in das Umfeld der Gruppe geraten war.
Jan-Carl Raspe
Jan-Carl Raspe wurde am 24. Juli 1944 in Berlin geboren. Sein Vater war bereits vor seiner Geburt verstorben und er verbrachte seine Kindheit zusammen mit seinen beiden älteren Schwestern, seiner Mutter und zwei Tanten in einem Haus in Ostberlin. Als 1961 der Grenzübergang zwischen Ost und West geschlossen und die Berliner Mauer errichtet wurde, befand er sich im westlichen Teil der Stadt, wo er zur Schule ging. Er kam bei Verwandten unter und beschloss in Westberlin zu bleiben. Nach dem Abitur 1963 begann er ein Studium der Chemie, wechselte aber nach zwei Semestern zur Soziologie. Er engagierte sich in der Studentenbewegung, war bei den Protesten gegen den Schahbesuch 1967 dabei und wurde einer der Gründer der im selben Jahr entstandenen „Kommune II“. Nachdem er sein Diplom in Soziologie mit „Sehr gut“ bestanden hatte, zog er mit seiner Freundin Marianne in eine kleine Wohnung, die nach der Rückkehr der Gruppe um Baader und Meinhof zu einem Zufluchtsort wurde. Ab Herbst 1970 war er auch selbst an Aktionen der Gruppe beteiligt.
Die Gruppe war sich über das weitere Vorgehen nicht einig. Die von Baader verlangten größeren Aktionen, etwa die Entführung bekannter Politiker wie Franz Josef Strauß oder des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, wurden von der Gruppe mehrheitlich abgelehnt. Man beschränkte sich auf die Planung neuer Banküberfälle, wie etwa dem in Kassel am 15. Januar 1971, bei dem zwei Banken gleichzeitig überfallen und etwa 100.000 Mark erbeutet wurden.
Anfang desselben Jahres veröffentlichte Horst Mahler aus der Haft heraus sein „Positionspapier“, in dem er versuchte, die Ziele der Stadtguerilla darzulegen. Er hatte sich dabei nicht mit dem Rest der Gruppe abgesprochen, die dementsprechend empört waren und sich von Mahlers Veröffentlichung distanzierten. Ulrike Meinhof bekam den Auftrag, ein eigenes Manifest der Gruppe zu schreiben. Mitte des Jahre war „Das Konzept Stadtguerilla“ fertig. Auf dem Titelblatt tauchte erstmals der rote Stern mit der „Heckler & Koch MP5“ auf. Darunter prangten die Buchstaben RAF. Über die Benennung der Gruppe als Rote Armee Fraktion war gemeinsam entschieden worden – auch wenn einigen Mitgliedern später Zweifel kamen, da RAF bereits als Abkürzung für die Royal Airforce in Gebrauch war und der Name Rote Armee bei vielen Deutschen schlechte Erinnerungen an das Kriegsende wachrief.
Kurz darauf, am 15. Juli 1971 wurde Petra Schelm bei einem Fluchtversuch nach einer Verkehrskontrolle erschossen. Sie war das erste Todesopfer in den Auseinandersetzungen zwischen RAF und Staat. Doch wenig später hatte die Polizei einen ersten Verlust zu beklagen: Gerhard Müller erschoss in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober den Polizeimeister Norbert Schmid bei einer Personenkontrolle.
Jetzt zeigt sich auch, wie die RAF mit Aussteigern verfuhr, die andere Mitglieder der Polizei auslieferten: Edelgard Gräfer, der die Polizei drohte, sie würde ihren Sohn nicht wieder sehen, sollte sie keine Aussagen machen, lieferte die gewünschten Informationen – und wurde in einer Racheaktion der RAF mit einem Eimer Teer übergossen.
Beide Seiten hatten jetzt „den Finger locker am Abzug“. Bei einem Banküberfall in Kassel am 22. Dezember 1971, bei dem rund 150.000 Mark erbeutet wurden, erschoss die RAF einen zum Tatort gerufenen Polizisten.
Bombenanschläge
Als die amerikanische Luftwaffe in Vietnam damit begann, nordvietnamesische Häfen zu verminen, sah die RAF sich veranlasst, den USA zu zeigen, dass „für die Ausrottungsstrategen von Vietnam Westdeutschland und West-Berlin kein sicheres Hinterland mehr sei.“
Am 11. Mai 1972 explodierten im IG-Farben-Haus in Frankfurt am Main, wo das Offizierscasino des V. US-Korps untergebracht war, drei Rohrbomben. Ein amerikanischer Soldat wurde getötet, 13 weitere wurden verletzt.
Doch das war erst der Anfang einer Serie von Sprengstoffanschlägen in Deutschland. Am nächsten Tag verletzten zwei Sprengsätze, die in der Augsburger Polizeidirektion explodierten, fünf Menschen. Nur Stunden später explodierte im Hof des LKA in München eine Autobombe. Diesmal wurden keine Menschen verletzt.
Am 15. Mai missglückte ein geplanter Anschlag auf den Bundesrichter Buddenberg. Die Bombe, die ihn in seinem Fahrzeug töten sollte, erwischte stattdessen seine Frau; diese überlebte verletzt.
Da eine Telefonistin des Springerverlags in Hamburg eine telefonische Bombendrohung nicht ernst nahm, wurden durch die Detonation von drei Bomben am 19. Mai insgesamt 17 Menschen verletzt; die Polizei konnte weitere Sprengkörper rechtzeitig entschärfen.
Seinen traurigen Höhepunkt fand die Anschlagsserie am 24. Mai 1972 in Heidelberg. Durch die Explosion von zwei Autobomben im Europa-Hauptquartier der US-Armee wurden insgesamt drei US-Soldaten getötet, fünf weitere wurden verletzt.
Die Kader werden verhaftet
Die Polizei reagierte auf die Anschläge mit der größten Fahndungsaktion, die die Bundesrepublik Deutschland je erlebt hatte. Am 31. Mai 172 befanden sich im Rahmen der »Aktion Wasserschlag« sämtliche Hubschrauber im Besitz des Staates in der Luft, um entlang der Autobahnen Straßensperren zu errichten und so die Bundesrepublik „richtig durchzuklopfen“, wie es der damalige BKA-Chef Horst Herold ausdrückte. Schlussendlich führte die Aktion jedoch zu keinem Fahndungserfolg.
Doch bereits einen Tag darauf änderte sich etwas. In den frühen Morgenstunden des 1. Juni 1972 näherten sich drei Männer – Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Holger Meins – einer von der Polizei observierten Garage, die der RAF als Sprengstofflager diente. Baader und Meins begaben sich in die Garage während Raspe draußen Wache hielt. Als die Polizeibeamten auf Raspe zugingen, eröffnet dieser das Feuer und flüchtete, wurde jedoch schließlich auf einem Gartengrundstück gestellt, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ. Baader und Meins jedoch verschanzten sich in der Garage, wo sie nach kurzer Zeit von einem Großaufgebot der Polizei umzingelt waren und erst aufgaben, nachdem Baader durch einen gezielten Schuss aus einem Scharfschützengewehr verletzt wurde.
Eine Woche später wurde auch Gudrun Ensslin in einer Hamburger Modeboutique verhaftet; eine der Verkäuferinnen hatte den Revolver gesehen, den sie bei sich trug und die Polizei alarmiert. Die Schlinge zog sich nun immer enger, und als es der Polizei aufgrund des Tipps eines Hannoveraner Lehrers am 15. Juli 1972 gelang, auch noch Ulrike Meinhof und Gerhard Müller festzunehmen, befand sich die gesamte Führungsspitze der RAF in Haft.
Im Gefängnis
Innerhalb von zwei Wochen war es der Polizei also gelungen, alle wichtigen Führungspersönlichkeiten zu fassen. Diese saßen nun über die ganze Bundesrepublik verteilt in den Gefängnissen der Stadt, in der sie verhaftet worden waren, und klagten über die Haftumstände, die sie als „Isolationsfolter“ bezeichnen. Um ihre Forderungen nach Hafterleichterungen durchzusetzen, organisierten sie über das von Gudrun Ensslin entwickelte System des Nachrichtenaustauschs über die damals noch unkontrollierte Post der Verteidiger bald den ersten Hungerstreik. Die Häftlinge sahen ihren Körper als letzte „Waffe“ die sie noch hatten, und so bliebb es nicht bei diesem einen Hungerstreik. Am 9. November 1974, während des dritten Hungerstreiks, starb schließlich Holger Meins an den Folgen seiner Unterernährung. Nun zeigten die Streiks tatsächlich Wirkung: Fast alle inhaftierten RAF-Mitglieder wurden bis 1975 im Hochsicherheitstrakt der gerade fertig gestellten JVA Stuttgart-Stammheim verlegt und die Haftbedingungen wurden gelockert; die Häftlinge konnten sich untereinander mehrere Stunden an Tag treffen und erhielten nun fast täglich Besuch von ihren Anwälten.
Die Entstehung der Zweiten Generation
Nachdem alle Führungspersönlichkeiten der so genannten Ersten Generation verhaftet waren, rückten andere nach. Die meisten waren bereits vorher in der RAF aktiv gewesen, hatten aber nicht zum engsten Kern der Gruppe gehört. Zudem wurden auch viele durch die propagandistische Wirkung, die Baader und die anderen aus dem Gefängnis heraus und bei ihrem Prozess entwickelten, dazu bewegt, sich der weiter agierenden und sich vornehmlich auf die Befreiung der Inhaftierten konzentrierenden Gruppe anzuschließen.
Die Geiselnahme von Stockholm
Ende Februar 1975 war es der »Bewegung 2. Juni«, einer der RAF ähnlichen linksextremistischen Terrorgruppe, gelungen, durch die Entführung des CDU-Politikers Peter Lorenz die Freilassung von fünf inhaftierten Gruppenmitgliedern zu erpressen. Scheinbar davon inspiriert, versuchte nun auch die RAF, den Staat zu erpressen und so die Freilassung der Gefangenen zu erwirken:
Es war der 24. April 1975, kurz vor zwei Uhr in der Früh. Eine Gruppe von sechs RAF-Terroristen – bestehend aus Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel sowie Siegfried Hausner – die sich selbst „Kommando Holger Meins“ nannten, stürmten die Deutsche Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und nahmen zwölf Menschen als Geisel und verbarrikadierten sich im oberen Stockwerk. Sie forderten die Freilassung von 26 Gefangenen, darunter die Kader der Ersten Generation: Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe.
Als nun die schwedische Polizei anrückte und das untere Stockwerk besetzte, drohten die Terroristen mit der Erschießung der Geiseln. Die Polizei nahm die Drohung nicht ernst genug und rückte nicht ab, woraufhin die Geiselnehmer den deutschen Militärattaché Andres Baron von Mirbach auf den Flur brachten und ihn dort erschossen. Die schreckliche Aktion zeigte ihre beabsichtigte Wirkung: Die Polizei zog sich zurück.
Derweil war die Bundesregierung in Berlin nicht bereit, den Forderungen der RAF nachzugeben: Bundeskanzler Helmut Schmidt brachte es auf die Formulierung „Meine Herren, mein ganzer Instinkt sagt mir, dass wir hier nicht nachgeben dürfen.“
Diese Entscheidung wurde den Geiselnehmern gegen 20:00 Uhr mitgeteilt. Ihre Antwort bestand in der Erschießung einer weiteren Geisel, Wirtschaftsattaché Heinz Hillegaart, gegen 22:20 Uhr.
Kurz vor Mitternacht: Die schwedische Polizei war kurz davor, das Gebäude unter Einsatz von Betäubungsgas zu stürmen, als eine Detonation das Gebäude erschütterte. Die Terroristen hatten – versehentlich, wie sich später herausstellen sollte – den im Gebäude installierten Sprengstoff zur Explosion gebracht. Der Geiselnehmer Ulrich Wessel war sofort tot, doch auch alle anderen Personen im Gebäude erlitten schwere Verbrennungen. Siegfried Hausner starb zehn Tage später in Haft an den Folgen seiner Verletzungen.
Die als Befreiungsaktion geplante Geiselnahme war gescheitert; die vier Terroristen, die überlebten, wurden später zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.
Die Stammheimer Prozesse I
Am 21. Mai 1975 begann die Staatsanwaltschaft damit, die 354 Seiten umfassende Anklageschrift gegen Baader, Ensslin, Meinhof und Raspe zu verlesen. Im Vorfeld des Prozesses, der in der eigens zu diesem Zweck errichteten Mehrzweckhalle in Stammheim stattfand, hatte der deutsche Bundestag zahlreiche Sondergesetze erlassen, was dazu führte, dass die RAF-Anwälte Klaus Croissant, Kurt Groenewold und Hans-Christian Ströbele nicht zum Prozess zugelassen wurden und Baader ohne Verteidiger seines Vertrauens dastand. Anträge, den zugeteilten Pflichtverteidigern die Mandate zu entziehen, wurden abgelehnt.
Von Beginn an störten die Angeklagten die Verhandlung, beleidigten ihre Pflichtverteidiger und den Vorsitzenden Richter Dr. Prinzing, was meist zum Ausschluss der Angeklagten vom Verfahren führte. Als diese sich durch einen neuerlichen Hungerstreik verhandlungsunfähig machen wollten, wurde ein neues Gesetz verabschiedet, dass die Fortführung einer Verhandlung erlaubte, sollten die Angeklagten ihre Verhandlungsunfähigkeit selbst verschulden.
Anträge darauf, Politiker wie den ehemaligen US-Präsidenten Nixon, die Bundeskanzler Brandt, Schmidt und Erhard sowie die Bundespräsidenten Kiesinger und Scheel als Zeugen zu laden, um zu beweisen, dass der Völkermord in Vietnam auch von deutschen Boden aus koordiniert worden war und so die Anschläge auf US-Einrichtungen gerechtfertigt seien, wurden abgelehnt.
Der Tod der Ulrike Meinhof
Als zwei Justizbeamte am Morgen des 9. Mai 1976 Zelle 719 öffneten, fanden sie die darin inhaftierte Ulrike Meinhof tot auf. Sie hatte sich in der Nacht am Fensterkreuz erhängt; den Strick hatte sie aus einem Anstaltshandtuch hergestellt, das sie in Streifen gerissen hatte.
Sowohl die amtliche Obduktion als auch die von Meinhofs Schwester veranlasste Nachobduktion führten zu dem Befund: Suizid durch Strangulation, keine Fremdeinwirkung.
Die anderen Gefangenen wollten dies nicht wahrhaben und sprachen von einer Hinrichtung durch den Staat. Aus dem geheimen Nachrichtenaustausch zwischen den Gefangenen, insbesondere Baader und Ensslin, geht jedoch hervor, dass die Zweifel am Selbstmord nur gespielt waren. Hinzu kommt, dass Meinhof bereits Monate zuvor verlautet hatte, „Selbstmord sei der letzte Akt der Rebellion“.
Die Stammheimer Prozesse II
Bereits am zweiten Verhandlungstag hatten die Angeklagten behauptet, seit dem Jahr 1973 in ihren Zellen systematisch abgehört worden zu sein. Anfangs waren diese Behauptungen nur kopfschüttelnd als weiterer Beweis des Verfolgungswahns der RAF abgetan worden. Doch nun stellte sich heraus, dass die Gefangenen gar nicht so unrecht gehabt hatten. Nachdem sich die Hinweise weiter verdichtet hatten, traten Anfang 1977 schließlich die baden-württembergischen Minister für Justiz und Inneres vor die Presse und gaben zu, dass in den Jahren 1975, 1976 und 1977 mehrmals über Tage hinweg die Gespräche zwischen Angeklagten und Verteidigern mit Hilfe von Wanzen abgehört wurden. Da von den Technikern des Bundesamts für Verfassungsschutz sieben Wanzen installiert wurden, in Stammheim jedoch nur vier Räume für Gespräche zwischen Anwalt und Mandant vorhanden sind, muss wohl davon ausgegangen werden, dass auch die Privatgespräche der Inhaftierten abgehört wurden.
Am 25. Januar 1977 schließlich musste der Vorsitzende Richter Dr. Prinzing seinen Stuhl räumen: Das Gericht hatte dem von Otto Schily gestellten 85. Befangenheitsantrag stattgegeben und ersetze Prinzing nun durch den bislang nur beisitzenden Richter Dr. Foth. Der Grund für diesen Austausch war die Tatsache, dass Prinzing vertrauliche Prozessakten an Bundesrichter Albrecht Mayer weitergegeben hatte, dessen Strafsenat für eine eventuelle Revision des Prozesses zuständig gewesen wäre.
Nach 192 Prozesstagen wurde am 28. April 1977 das Urteil verlesen. Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, die bei der Urteilsverkündung nicht anwesend waren, wurden wegen mehrfachen Mordes, versuchten Mordes sowie wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Verteidigung legte Revision ein.
Die Ermordung von Siegfried Buback und Jürgen Ponto
Rückblick: Bereits drei Wochen vor der Urteilsverkündung hatten die Terroristen, die sich noch auf freiem Fuß befanden, wieder zugeschlagen: Es war der 7. April 1977, Gründonnerstag, und Generalbundesanwalt Siegfried Buback befand sich auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Als der Wagen, in dem sich neben Buback auch noch sein Chauffeur Wolfgang Göbel sowie dessen Vorgesetzter, Georg Wurster, befanden, an einer roten Ampel zum Stehen kam, hielt neben ihnen ein Motorrad, darauf zwei vermummte Gestalten. Plötzlich zückte einer von ihnen ein Maschinengewehr und eröffnete das Feuer. Als die Männer davon fuhren, waren Buback und Göbel bereits tot, Wurster starb wenig später im Krankenhaus. Wer die Täter sind, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.
Am 30. Juli 1977 betraten drei Personen das Haus des Dresdner Bank-Chefs Jürgen Ponto. Susanne Albrecht war der Familie bekannt, ihre Schwester war das Patenkind Pontos. Die anderen beiden waren Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar. Geplant war eine Entführung. Alles sah nach einem normalen Besuch aus, bis Klar plötzlich seine Pistole zog und sie auf Ponto richtete. Der nahm das alles zunächst gar nicht ernst und versuchte, Klar die Waffe aus der Hand zu schlagen. Dabei löste sich ein Schuss. Brigitte Mohnhaupt stürmte in den Raum und eröffnet edas Feuer. Die Kugeln trafen Ponto in Kopf und Brust, er erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Mohnhaupt, Klar und die völlig aufgelöste Albrecht flüchteten aus dem Haus und rasten mit dem Auto davon. Die geplante Entführung hatte sich in ein Mordkommando verwandelt.
Der Deutsche Herbst
Die Entführung des Hanns Martin Schleyer
Montag, 5. September 1977. Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer war auf dem Weg zu seiner Zweitwohnung in Köln. Als der Wagen in der Friedrich-Schmidt-Straße war, schoss ein gelber Mercedes auf die Straße. Schleyers Chauffeur bremste hart, und der hinter ihnen fahrende Wagen, in dem sich drei zum Schutz Schleyers abgestellte Polizisten befanden, fuhr auf. Vier Gestalten – Peter Jürgen Boock, Sieglinde Hofmann, Stefan Wisniewski und Willi-Peter Stoll – stürmten auf die Straße und deckten die Fahrzeuge mit einem Kugelhagel aus ihren Maschinengewehren ein. Schleyer wurde aus dem Wagen gezerrt und in einen bereitstehenden Fluchtwagen verfrachtet. Die Terroristen rasten davon. Von Schleyers Begleitern hatte keiner die Schießerei überlebt.
Während die von BKA und Polizei sofort ausgelöste Ringfahndung lif, wechselten die Entführer mit Schleyer in einer Tiefgarage das Fahrzeug. Ein dort hinterlegter Brief an die Bundesregierung, der vom „Kommando Siegfried Hausner“ unterzeichnet war, verkündete die Forderungen: Die Freilassung von 11 inhaftierten RAF-Terroristen, darunter Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Jedem der Freizulassenden sollten 100.000 Mark mitgegeben werden.
Schleyer wurde in eine konspirative Wohnung in Erfstadt-Liblar gebracht, 30 Minuten entfernt vom Tatort, wo er vermutlich die ersten 10 Tage seiner Entführung verbrachte.
Der harte Kurs der Bundesregierung
Die Bundesregierung um Bundeskanzler Helmut Schmidt war sich schnell über das weitere Vorgehen einig: Man will einen „harten Kurs“ fahren und den Forderungen der Entführer unter keinen Umständen nachgeben.
Das weitere Vorgehen gestaltete sich jedoch als schwierig: Der Plan, die gesamte Polizeiarbeit dem BKA zu unterstellen, führte in erster Linie zu einem großen Chaos. Durch fehlendes Personal, mangelnde Abstimmung der Beamten untereinander und aufgrund überlasteter Infrastrukturen gingen in den ersten Tag massenhaft Ermittlungsergebnisse verloren. Das Versagen der Polizei mutete geradezu grotesk an, wenn man bedenkt, dass das Schleyer-Versteck mithilfe der Rasterfahndung bereits zwei Tage nach der Entführung gefunden war, dieses aber aufgrund mangelnder Befehle nicht betreten wurde. Die Information ging schließlich in der Masse von Daten verloren.
Die Terroristen verbrachten Schleyer nach zehn Tagen in eine Wohnung im niederländischen Den Haag. Kurz darauf reiste ein Teil der Gruppe nach Bagdad ab, wo ihnen Abu Hani, der Chef der PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine), seine Hilfe anbot. Diese Hilfe bestand aus einer bereits fertig geplanten und durchführbereiten Flugzeugentführung, mit der die Gefangenen in Stammheim freigepresst werden sollten.
Derweil bemühte sich die Bundesregierung, ein Land zu finden, dass bereit war, die Terroristen im Falle eines Austausches aufzunehmen. Scheinbar lehnten alle befragten Länder ab, was allein schon deshalb unglaubwürdig wirkt, weil Algerien sich wenige Tage zuvor bereit erklärt hatte, japanische Terroristen aufzunehmen, die dort ebenfalls mit einer Flugzeugentführung freigepresst wurden.
Währenddessen eskalierte die Situation in Stammheim immer weiter: Seit dem Beginn der Schleyer-Entführung befinden sich die Häftlinge in Isolationshaft und unterlagen einer Kontaktsperre. Die rechtliche Grundlage hierfür war vom Bundestag erst nachträglich als Sondergesetz zurecht gezimmert worden. Während der Staat bei seinem Verhandlungen weiter auf eine Verzögerungstaktik setzte, sprachen die inhaftierten RAF-Mitglieder indirekt schon von Selbstmordgedanken.
Die Entführung der „Landshut“
13. Oktober 1977, kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit: Die Landshut, eine Boeing 737 der Lufthansa, befand sich mit 86 Passagieren an Bord auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main, als plötzlich in der Economy-Class ein Tumult ausbrach. Zwei bewaffnete Männer stürmten zum Cockpit und zogen die Piloten heraus. Zwei Frauen stellten sich mit Handgranaten in den Gang. Der Anführer der Terroristen, der sich selbst als „Captain Martyr Mahmud“ vorstellte, befahl den Fluggästen über den Bordlautsprecher: „Hands up! Follow the instructions!“.
Um 14:38 meldeten die französischen Behörden am Boden, dass die Maschine vom planmäßigen Kurs abweicht. Tatsächlich leiteten die Terroristen das Flugzeug nach Rom um, wo es aufgetankt wurde. Dort wurden erstmals öffentlich die Forderungen der Entführer verlesen: Sie waren identisch mit denen der Schleyer-Entführung. Dann hob die Landshut wieder ab und nahm Kurs auf Larnaka in Zypern, wo sie um 20:30 Uhr für einen erneuten Tankstopp landete. Eine halbe Stunde zuvor hatte die Bundesregierung „ihren letzten Hund von der Kette gelassen“: Die GSG9 der Bundespolizei, eine Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung, vor deren Einsatz bislang immer zurück geschreckt worden war, folgte dem entführten Flugzeug. Weitere Zwischenlandungen folgten in Bahrain und Dubai. Mittlerweile hatte das BKA mit der Unterstützung von Computern die Identität der Flugzeugentführer, die sich selbst als „Kommando Martyr Halimeh“ bezeichneten, herausgefunden: Captain Martyr Mahmud hieß in Wirklichkeit Zohair Youssif Akache, Soraya Ansari war Souhaila Andrawes, Riza Abbasi war Wabil Harb und hinter Shanaz Gholoun verbarg sich Hind Alameh.
Die Maschine flog weiter nach Aden im damaligen Südjemen. Da die Regierung dort jedoch alle Landebahnen blockieren ließ, war der Pilot gezwungen, auf einem schmalen Sandstreifen neben der Piste zu landen. Jürgen Schumann, der Pilot der Landshut, verließ das Flugzeug, um das Fahrwerk nach eventuellen Schäden zu untersuchen. Als er jedoch verspätet zurückkehrte, wurde er von Captain Martyr Mahmud erschossen. Nur noch vom Copiloten gesteuert, hob die Maschine wieder ab und nahm Kurs auf ihr endgültiges Ziel: Mogadischu, die Hauptstadt von Somalia.
Operation Feuerzauber
Am frühen Morgen des 17. Oktober landete die Landshut in Mogadischu. Die Entführer erneuerten ihr Ultimatum und drohten mit der Sprengung des voll besetzten Flugzeugs, sollten die in Stammheim Inhaftierten nicht bis 15:00 Uhr freigelassen werden. In letzter Minute lenkte die Bundesregierung zum Schein ein und konnte unter dem Vorwand, es dauere mehrere Stunden, um die Gefangenen von Frankfurt nach Somalia zu fliegen, das Ultimatum nochmal um einige Stunden verlängern. Inzwischen iwar die Maschine mit der GSG9 an Bord in Mogadischu gelandet. Während die Spezialeinheit die Ausrüstung entlud, hielt der Tower ständigen Funkkontakt mit den Entführern, um sie abzulenken.
Dann, am 18. Oktober um 0:05 Uhr erfolgte der Zugriff: Mit Blendgranaten der britischen Spezialeinheit SAS (Special Air Service) wurden die Entführer für einen Moment handlungsunfähig gemacht. Dann stürmten vier Gruppen das Flugzeug und eröffneten das Feuer. Drei der Entführer starben im Kugelhagel, nur Souhaila Andrawes überlebte schwer verletzt. Nach nur sieben Minuten war der Spuk vorbei. Die Passagiere wurden über die Tragflächen aus dem Flugzeug gebracht. Nach über hundert Stunden in der Hand der Terroristen war ihr Martyrium vorbei. Als der Deutschlandfunk um 0:38 Uhr die Meldung vom Ende der Entführung brachte, hörten auch die Gefangenen in Stammheim mit…
Die Todesnacht von Stammheim
Was sich im siebten Stock der Justizvollzugsanstalt Stammheim in dieser Nacht genau abspielte, wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Als um 7:41 Uhr des 18. Oktober 1977 die Beamten Jan-Carl Raspes Zelle öffneten, fanden sie den Gefangenen röchelnd und aus einer Wunde am Kopf blutend auf seinem Bett; neben ihm eine Pistole. Obwohl sofort ein Notarzt verständigt und Raspe in ein Krankenhaus gebracht wurde, verstarb dieser gegen 9:40 Uhr im Operationssaal.
Nach Raspes Abtransport ins Hospital wurde um kurz nach 08:00 Uhr die Zelle von Andreas Baader geöffnet: Hier kam jedoch jede Hilfe zu spät, die Beamten konnten nur noch den Tod des in einer Blutlache liegenden Gefangenen feststellen. Auch Gudrun Ensslin wurde tot in ihrer Zelle gefunden, erhängt mit einem Lautsprecherkabel am Zellenfenster. Einzig Irmgard Möller lebte noch, die Stichverletzungen in der Herzgegend waren nicht tödlich.
Der Obduktionsbefund am Abend ergab: „Die bisherigen Feststellungen bei allen drei Toten sprechen nicht gegen Selbstmord, sondern lassen sich alle durch Selbstmord erklären.“
Das Ende des Deutschen Herbstes
„Wir haben nach 43 Tagen Hanns-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles Peguy in Mühlhausen in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen.“
Mit dieser Erklärung des „Kommando Siegfried Hausner“, das sich als verantwortlich für die Schleyer-Entführung bekannte, endete der Deutsche Herbst. Als Reaktion auf die gescheiterte Flugzeugentführung in Mogadischu und die Selbstmorde in Stammheim hatten die Terroristen ihre Drohung wahr gemacht und Schleyer erschossen. Die Identität der Täter – Stefan Wisniewski und Rolf Heißler – wurde erst dreißig Jahre später, im Jahr 2007, offenbar, als das ehemalige RAF-Mitglied Peter Jürgen Boock sein Schweigen brach.
Von der Dritten Generation bis zur Selbstauflösung
Das Ende der Zweiten Generation
Nach dem Ende der Stammheimer traten in der RAF immer mehr Schwierigkeiten auf. Viele wollten nicht an einen Selbstmord glauben und gaben sich wilden Verschwörungstheorien über vom Staat verordnete Morde hin. Zudem fehlte zusehends die Motivation für weitere Aktionen: Die Zweite Generation hatte sich im Wesentlichen darauf konzentriert, die Kader der Ersten Generation aus dem Gefängnis zu bekommen; ein Ziel, das nun nicht weiter zu verfolgen war.
Abgesehen von einem Bombenanschlag auf den Oberbefehlshaber der NATO in Europa, Alexander Haig, am 25. Juni 1979, der keine Todesopfer forderte, waren die von der RAF, zu der sich ab 1980 die restlichen Mitglieder der linksextremistischen Terrororganisation „Bewegung 2. Juni“ gesellten, verübten Aktionen hauptsächlich Banküberfälle.
Das Ende der Zweiten Generation läutete die Verhaftung von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar im November des Jahres 1982 ein. „Die alte RAF ist zu Ende gegangen“ formulierte es BKA-Chef Horst Herold, der bereits ein Jahr zuvor pensioniert worden war.
Die Dritte Generation
Ein genaues Datum für den Anfang der Dritten Generation gibt es selbstverständlich nicht, doch ist es wohl zweckmäßig, die Veröffentlichung des so genannten Maipapiers im Mai 1982 als Ausgangspunkt zu wählen, in dem eine Änderung des Kurses der RAF angekündigt wurde. Das neue Konzept beinhaltete nicht nur die Bildung einer „antiimperialistischen Front“, sondern auch militärische Angriffe, koordinierte militante Projekte (zusammen mit anderen linken Terrorgruppen in Europa, wie der Action Directe in Frankreich und den Brigate Rosse in Italien), aber auch politische Initiativen.
Doch die Dritte Generation unterschied sich auch in anderen Punkten deutlich von der früheren RAF: So sind bis heute kaum Namen der Mitglieder beziehungsweise Täter bekannt, was auch auf das deutlich professionellere Vorgehen in dieser Zeit zurückzuführen ist. Dies ist auch der Hauptgrund, warum viele bezweifeln, dass es überhaupt jemals eine Dritte Generation gab.
Der Terror geht weiter
18. Dezember 1984: Nur ein glücklicher Zufall in Form eines fehlerhaften Zünders verhinderte die Explosion von 25 Kilogramm Sprengstoff auf dem Gelände der NATO-Schule in Oberammergau und rettete so den 43 Menschen im Gebäude das Leben. Doch das war nur ein dunkler Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte:
Am 1. Februar 1985 drangen Unbekannte in das Haus von Ernst Zimmermann in Gauting ein, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Motoren- und Turbinen-Union (MTU) und des BDLI (Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie), und richteten ihn in seinem eigenen Schlafzimmer durch einen aufgesetzten Schuss in den Hinterkopf hin. Die Täter sind bis heute unbekannt.
Im August desselben Jahres dann der nächste Anschlag: Nachdem der erst zwanzigjährige US-Soldat Edward Pimental in einem Waldstück erschossen und seiner Identification Card beraubt wurde, explodierte am selben Tag, dem 8. August 1985, eine Autobombe auf den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Rhein-Main-Airbase in Wiesbaden. Bei dem Anschlag, der eine Kooperation aus RAF und der französischen Action Directe war, kamen zwei Menschen ums Leben, elf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Später wurden Birgit Hogefeld und Eva Fraule als Täter verurteilt.
Ein Jahr später ging der Terror weiter: Ein 50 Kilogramm schwerer Sprengsatz tötete am 9. Juli 1986 den Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts und seinen Chauffeur Eckhard Groppler. Am 10. Oktober 1986 wurde der Diplomat des Außenministeriums, Gerold von Braunmühl, vor seinem Haus in Bonn erschossen. Bei beiden Taten ist bis heute ungeklärt, wer die Täter waren.
30. November 1989: Nach einer Zeit verhältnismäßiger Ruhe war der Terror zurück. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, fiel einem Sprengstoffanschlag zum Opfer: Nachdem die Wucht der Explosion die gepanzerte Limousine von der Straße geworfen hatte, verblutete er im Fond des Wagens aufgrund einer Verletzung der Schlagader. Auffällig ist vor allem, dass die eingesetzte Technik, nämlich eine Lichtschranke und Bombe militärischer Bauart mit TNT als Sprengstoff, untypisch für die RAF war.
Ein weiterer Wirtschaftsmagnat lässt sein Leben, als die RAF in einer Kommandoaktion am Abend des 1. April 1991, Ostermontag, den Chef der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder am Fenster seines Hauses in Düsseldorf erschoss.
„Wir haben uns entschieden, dass wir … die Eskalation zurücknehmen“
Als nach dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung 1990 die Archive der Stasi auch für westdeutsche Behörden geöffnet werden, gelang es, zehn ehemalige RAF-Mitglieder, die sich in den Arbeiter- und Bauernstaat abgesetzt hatten, zu enttarnen. Bundesjustizminister Klaus Kinkel bot daraufhin Anfang 1992 den RAF-Gefangenen Haftentlassungen an, sollten die in Freiheit agierenden Gesinnungsgenossen auf weitere Aktionen verzichten. Die Reaktion der RAF folgt drei Monate später mit einer Erklärung, in der es heißt:
„Wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstellen.“
Dass diese neue Regelung das Einstellen von Aktionen gegen Staatseigentum nicht impliziert, zeigte sich ein Jahr später: In der Nacht vom 26. auf den 27. März 1993 verschaffte sich eine Kommandogruppe der RAF, die sich selbst in einem späteren Bekennerschreiben als „Kommando Katharina Hammerschmidt“ bezeichnet, Zugang zum Gelände der gerade fertig gestellten Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt. Die wachhabenden Sicherheitsleute wurden überwältigt und in einen Transporter einige hundert Meter weiter gebracht. Dann wurden die mitgebrachten 200 Kilogramm Sprengstoff installiert. In den frühen Morgenstunden verwandelten fünf Explosionen die Haftanstalt in den teuersten Trümmerhaufen der Bundesrepublik; der Schaden betrug etwa 100 Millionen Mark.
Die letzte Konfrontation zwischen Polizei und RAF fand am 27. Juni 1993 auf dem Bahnhof von Bad Kleinen statt, einer kleinen Stadt nahe Schwerin. Dem bereits seit Jahren in der RAF-Szene agierende V-Mann des Verfassungsschutzes Klaus Steinmetz war es gelungen, ein Treffen mit Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams, beide Teil der Führungsebene der Dritten Generation, zu arrangieren. Doch der Plan, die Terroristen in einer Unterführung des Bahnhofs festzunehmen, ging nicht auf: Während es den Spezialisten der GSG9 gelang, Birgit Hogefeld zu überwältigen, konnte Wolfgang Grams die Treppen zum Bahnsteig hinaus flüchten. Es folgte ein Schusswechsel, den der Polizeibeamte Michael Newrzella nicht überlebt. Auch Grams starb, doch die Frage nach dem „Wie“ ist bis heute nicht genau beantwortet. Die offizielle Darstellung der Staatsanwaltschaft legt einen Selbstmord des verletzten Grams nahe, der so einer Festnahme entgehen wollte.
Am Ende: Die Selbstauflösung
„Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF: Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte.“
Diese Worte bildeten die Einleitung der achtseitigen, vom BKA als authentisch eingestuften Selbstauflösungserklärung der RAF, die am 20. April 1998 der Nachrichtenagentur Reuters zugespielt wurde. Sie sind somit der Anfang vom Ende dessen, was beinahe dreißig Jahre lang Westdeutschland terrorisiert hat.
Am Ende musste die RAF selbst zugeben, dass ihr Plan vom antiimperialistischen Kampf gescheitert ist. Von Reue trotzdem keine Spur: „Das Ende dieses Projekts zeigt, daß wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der Revolte.“
Dieser Artikel wurde uns von Timothy, der das Pseudonym Bookworm nutzt, zur Verfügung gestellt und am 07. November 2009 veröffentlicht. Eine Überarbeitung durch den Betreiber von Geschichte-Wissen erfolgte am 14.01.2024.