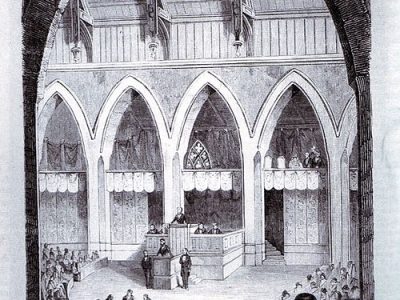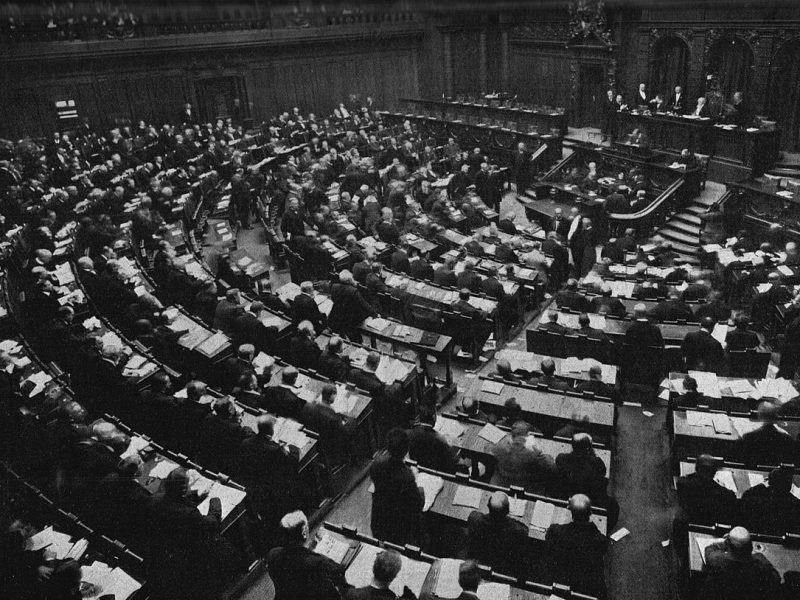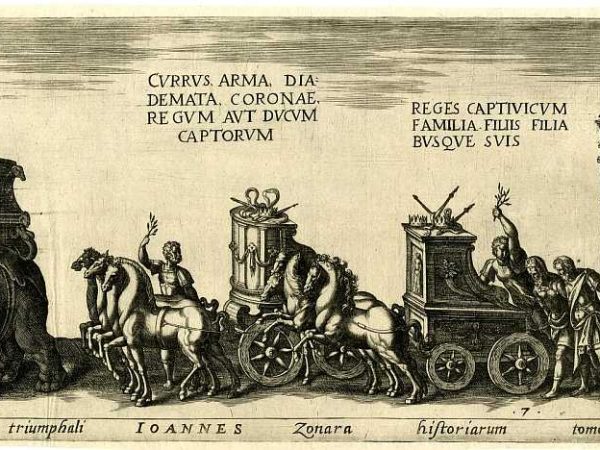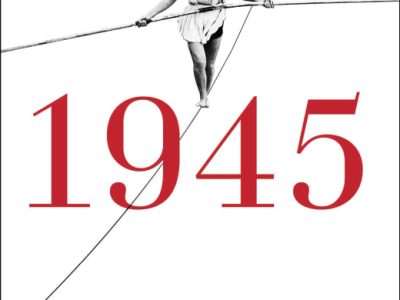Es freut uns, unseren Leserinnen und Lesern zwei fiktionale Geschichten präsentieren zu können, die Geschichte auf eine andere Art vermitteln, als es Sachberichte können. Der Autor Dr. Joseph Cronin, Dozent an der Queen Mary Universität in London, erzählt mit seinen zwei Kurzgeschichten von der Verfolgung und Vernichtung der Juden in Danzig während des Nationalsozialismus – aus zwei Perspektiven, die zum Nachdenken anregen sollen.
–

–
Herr Rosenbaum in seinem Nachthemd
Obwohl heute der Sabbat ist, muss Erwin Lichtenstein arbeiten. Er macht die Runde der jüdischen Geschäfte in der Danziger Innenstadt. Lichtenstein ist gesetzlicher Vertreter der jüdischen Gemeinde in Danzig. Es ist gegen Mittag, am 12. November 1938. Lichtenstein sammelt Informationen, da es sich herumgesprochen hat, dass ein Angriff auf die Große Synagoge an der Reitbahn geplant ist. Für diesen Abend.
Sobald er das festgestellt hat, geht Lichtenstein sofort in die Privatwohnung des neuen, amtierenden Vorsitzenden der Gemeinde, dem Rechtsanwalt Bernhard Rosenbaum. Vor vier Tagen hat der letzte gewählte Gemeindevorsitzende die Stadt verlassen.
Rosenbaums Hausmädchen öffnet die Tür. „Herr Rosenbaum ruht sich eigentlich gerade aus“, erzählt sie Lichtenstein. (Rosenbaum ist Mitte sechzig.) Lichtenstein entschuldigt sich, dass er ihn stören muss, sagt aber, dass er glaubt, Rosenbaum werde ihm die Störung verzeihen. Die Angelegenheit ist dringend. Lichtenstein und das Hausmädchen gehen in den ersten Stock, und sie klopft zweimal laut an die Tür zu Rosenbaums Schlafzimmer.
„Herr Rosenbaum!“ ruft sie. „Der Herr Lichtenstein ist hier, um mit Ihnen zu sprechen. Er sagt, es geht um etwas Wichtiges.“
Ein Moment vergeht und dann kommt eine Stimme hinter der Tür: „Also sagen Sie ihm, er soll reinkommen!“
Das Hausmädchen öffnet die Tür, und Lichtenstein betritt den Raum. Die Fensterläden sind geschlossen, und es ist drinnen dunkel. Rosenbaum sitzt auf der Bettkante. Er trägt ein Nachthemd und sieht, wie Lichtenstein es später beschreibt, ‚müde und ruhebedürftig‘ aus.
Lichtenstein berichtet Rosenbaum: er hat es aus guten Quellen, dass die Nazis planen, heute Abend die Synagoge auf der Reitbahn in Brand zu stecken. Eine Situation, die vor drei Tagen noch als weit hergeholt empfunden worden wäre, jetzt aber nach den neuesten Ereignissen in Deutschland mehr als wahrscheinlich erscheint. Etwas Ähnliches könnte auch in Danzig geschehen.
Rosenbaum schließt die Augen und führt die Fingerspitzen an die Stirn. „Nun“, sagt er leise. „Ich kann nicht behaupten, dass ich völlig überrascht bin.“
Die beiden schweigen einen Moment.
„Sehr gut“, sagt Rosenbaum und erhebt sich langsam von seinem Bett. „Dann sollten wir etwas dagegen tun.“
Rosenbaum geht voraus, in sein Arbeitszimmer. Er findet seinen Sessel und setzt sich hinein. Lichtenstein bleibt stehen.
Rosenbaum nimmt den Hörer des Telefons ab, das auf seinem Schreibtisch steht, und wählt die Telefonzentrale. „Polizei, bitte“, sagt er. Sie warten darauf, dass er durchgestellt wird. „Ja, guten Tag. Ich möchte mit dem Polizeipräsidenten sprechen.“
Eine Pause. „Nun, wenn er nicht da ist, würde ich gerne mit dem höchsten Offizier im Revier sprechen“, sagt Rosenbaum. „Es handelt sich um eine sehr ernste Angelegenheit.“
Noch eine Pause. „Guten Tag, Herr Offizier“, sagt Rosenbaum. „Hier spricht Rechtsanwalt Rosenbaum, der Vorsitzende der Judengemeinde.“ Lichtenstein berichtet, dass Rosenbaum ‚Judengemeinde‘ anstelle von ‚Synagogengemeinde‘ sagt. Aus irgendeinem Grund sagt er das immer. „Ich erfahre soeben“, fährt Rosenbaum fort, und seine Stimme steigt von Überzeugung, „dass ein Anschlag auf die Große Synagoge geplant ist. Ich fordere Sie hiermit auf, der Synagoge polizeilichen Schutz zu gewähren, um diesen verbrecherischen Anschlag zu verhüten.“
Das ist nicht schlecht, denkt Lichtenstein. Vor zehn Minuten schlief er.
Rosenbaum hört aufmerksam auf die Antwort. „Ausgezeichnet“, sagt er schließlich. „Ich freue mich zu hören, dass wir uns“ – er verlangsamt sich, um Nachdruck zu verleihen – „auf Ihre Unterstützung verlassen können.“ Er legt den Hörer auf.
„Sie schicken eine Patrouille, um die Angelegenheit nachzuprüfen“, sagt Rosenbaum zu Lichtenstein.
„Können wir uns darauf verlassen?“ fragt Lichtenstein.
„Welche Wahl haben wir?“ sagt Rosenbaum.
‚Dann‘, wie Lichtenstein es erzählt, ‚entließ er mich‘.
Als der Mob an diesem Abend bei der Synagoge ankommt, ist die Polizei schon da, um ihn abzufangen. Sie warten draußen auf der Reitbahn. Die SA-Männer fliehen, sobald sie sie merken. Es könnten diese Männer sein, oder es könnten andere sein, die an diesem Abend zur Synagoge in Zoppot, Danzigs Badeort, gehen und sie in Brand setzen. Die Feuerwehr kommt rechtzeitig an und löscht das Feuer.
Die Rede in der Holzfabrik
In den letzten Tagen hat Gauleiter Forster ein paar Reden an Arbeitsplätzen in der Stadt gehalten. Der Danziger Vorposten berichtet pflichtbewusst über die Vorgänge bei jedem einzelnen Auftritt. Kurz und knapp. Am Dienstagnachmittag hielt Forster eine Rede in der Firma Henking, einem Farbwerk. Der Gauleiter, so steht es in dem Bericht, ‚begründete an einzelnen Beispielen das schädliche Treiben des Judentums als Beherrscher des Geldes, als Anführer des deutschen Arbeiters in der Vergangenheit und als Zersetzer des deutschen Lebens.‘ In dieser Rede kündigt er auch an, ‚dass im Zusammenhang mit den Maßnahmen im Reich auch in Danzig auf direktem Wege an die Beseitigung des jüdischen Einflusses herangegangen wird.‘ Das bedeutet – ja, was meint der Herr Gauleiter? –, dass ‚die Einführung der Nürnberger Gesetzte demnächst auch bei uns erfolgen wird.‘ Es ist der 17. November 1938. Eine Woche nach der sogenannten ‚Reichskristallnacht‘.
‚In den letzten Monaten‘, fährt Forster fort, ‚ist eine Anzahl jüdischer Ladengeschäfte bereits verschwunden. Bis zu einem festen Termin soll die Arisierung der jüdischen Ladengeschäfte soweit fortgeschritten sein, dass auch nicht mehr ein einziger Judenladen besteht.‘ Diese Wörter sind fett gedruckt.
Vor vier Tagen wurde die Synagoge in Zoppot, Danzigs Badeort, niedergebrannt. Der Mob hatte es in der Nacht zuvor schon einmal versucht, aber die Feuerwehr traf rechtzeitig ein und löschte das Feuer. In der nächsten Nacht kehrte der Mob zurück, setzte die Synagoge erneut in Brand, und diesmal erschien die Feuerwehr nicht. Über 1000 Zoppoter Juden, die meisten davon polnische Einwanderer, sind bereits über die Grenze geflohen.
Es ist fast dunkel und es nieselt, als das schwarze Auto von der Adolf-Hitler-Straße durch das offene Tor zur Hugo Benders Holzbearbeitungsfabrik in Zoppot einbiegt. Nur einen halben Kilometer entfernt von der Ostseeküste, der Ort ist nicht besonders gut geschützt von dem beißenden Seewind, der über das Wellblechdach rasselt; der ganze Schutz für die Arbeiter, die Maschinen und das Holz.
Ein kleiner, streng aussehender Mann, der eine schwarze Uniform unter einem Ledermantel trägt, steigt aus dem Auto. Sein Chauffeur hat bereits die Beifahrertür geöffnet und hält mit beiden Händen einen Regenschirm über ihn. Er wirbelt im Wind herum. Der uniformierte Mann hat kurzes, schwarzes, drahtiges Haar und durchdringende kleine dunkle Augen. Er sieht sich um und zündet sich eine Zigarette an.
Eine Gestalt taucht aus einem kleinen weißen Gebäude neben dem Lagerhaus oben auf der Schotterauffahrt auf. Ein übergewichtiger Mann mit Brille und Weste geht schnell, mit einer Zeitung über dem Kopf, auf das geparkte Fahrzeug zu. „Mein verehrter Herr Gauleiter!“ sagt er, „Willkommen in meiner kleinen Holzfabrik! Ich bin Hugo Bender. Ihr Besuch ehrt uns.“
„Heil Hitler!“ sagt der uniformierte Mann und hebt seinen Arm.
„Heil Hitler“, antwortet der übergewichtige Mann und hebt den Arm mit der Zeitung.
„Reden Sie mich mit Forster an“, sagt der Gauleiter, „Und es freut mich, hier zu sein. Ich rede immer gerne mit Arbeitern.“ Forster spricht schnell, eintönig, ohne Emotion.
„Es sind gute Arbeiter“, sagt Hugo Bender. Er zeigt auf das schwarze Fahrzeug. „Schönes Auto! Was für ein Modell?“
„Weiß ich nicht“, antwortet Forster. „‘s ist ein Dienstwagen.“
„Ah“, sagt Bender.
Forster zieht an seiner Zigarette. „Ist die Presse schon angekommen?“ fragt er.
Bender nickt. „Vor ungefähr fünf Minuten“, sagt er. „Drei Männer mit … ja, Taschen und sowas. Einer hatte sogar eine Kamera. Aber in diesem Wetter wird man keine guten Fotos kriegen.“
„Ist egal“, sagt Forster. „Es kommt auf die Worte an.“
„Sie erwähnen meinen Namen im Bericht?“ fragt Bender leise.
Forster nickt, nimmt einen letzten Zug an seiner Zigarette und lässt den Stummel auf den Boden fallen. „Das wurde so vereinbart. Also“, sagt er, „gehen wir.“
„Ich werde Sie den Männern vorstellen“, sagt Bender, während sie den Schotterweg zum Lagerhaus entlang gehen. „Natürlich nicht, dass Sie eine Einführung überhaupt brauchen“, fügt er hinzu.
Sie gehen durch die geöffneten Türen. Im Lagerhaus haben sich ungefähr dreißig Männer um Reihen umgedrehter Kisten versammelt. Sie reden miteinander und rauchen. Einige der Männer sitzen auf den Kisten.
„Hier sind wir“, sagt Bender. „Wir haben ein kleines Podium für Sie aufgestellt.“ Er zeigt auf ein hölzernes Rednerpult am anderen Ende des Lagers. „Wir haben es heute selbst gebaut.“
„Sehr gut“, sagt Forster. „Bringen Sie die Männer dazu, näher zu kommen. Ich schreie nicht gern.“
Fünf Minuten später steht Forster hinter dem Rednerpult und schaut auf seine Notizen. Er hat mit den Journalisten gesprochen – er kennt sie alle mit Namen – und sie haben vereinbart, keine Fotos zu machen. Das Licht ist schlecht und außerdem gibt es keine Hakenkreuzfahne hinter dem Podium, wie es üblich ist. Sie ist nicht rechtzeitig angekommen. Der Regen fällt jetzt stärker, und das Prasseln dröhnt auf dem Welldach.
Die Männer sehen freundlich aus, denkt Forster, obwohl sie nach einem Arbeitstag müde sind und bei so einem Wetter noch in einer Scheune herumhängen müssen.
Die drei Journalisten, je einer von Danzigs verbleibende Nachrichtenagenturen, die jetzt alle im Besitz der Nazis sind, sitzen in der ersten Reihe, damit sie alles, was Forster sagt, hören und in Kurzschrift aufzeichnen können. Die Holzarbeiter sitzen hinten, einige tragen ihre Mäntel und haben ihre Taschen bereit, um nach Hause zu gehen. Aber sie wissen alle, wer Forster ist, sie wissen, dass er wichtig ist, und sie wissen, dass sie auf ihn hören müssen und keine Einwände werden erheben dürfen. Es wird keine Fragen geben.
Bender tritt auf das Podium und spricht die Menge an. „Meine lieben Belegschaftsmitglieder!“ sagt er. „Heute Abend haben wir die Ehre, unseren Gauleiter Albert Forster zu hören. Er wird zu vielen aktuellen und wichtigen Themen sprechen. Der Herr Gauleiter hätte zu jeder Danziger Firma sprechen können, und er hat sich entschieden, zu unserer Firma zu sprechen.“ Bender lächelt. „Ich vertraue darauf, dass Sie ihm Ihre volle und ungeteilte Aufmerksamkeit schenken werden. Gauleiter Forster“, sagt Bender, und deutet theatralisch auf das Podium, „Sie haben das Wort.“
Forster tritt vor, ordnet seine Notizen auf dem Rednerpult und räuspert sich. „Danke, Herr Bender“, sagt er. „Es ist mir eine Freude, an diesem schönen Abend“ – ein kleines Lachen geht von der Menge auf – „in Ihrer wundervollen Firma zu sprechen.“
Forster schaut zur Decke hoch, der Regen donnert jetzt auf das Welldach, sodass er seine Stimme erheben muss. „Meine Freunde!“ sagt er, „deutsche Arbeiter, Genossen im Kampf für den Nationalsozialismus! Ich habe nicht vor, euch lange zu behalten. Aber es ist wichtig, dass ich euch über die aktuelle Situation in Danzig informiere.“
‚Der Gauleiter sprach außerordentlich interessant und lebendig zur allgemeinen politischen Lage, über Industrie und Wirtschaft‘, schrieb einer der Journalisten in seinem Bericht, der am nächsten Tag in der Danziger Neuesten Nachrichten veröffentlicht wurde.
Nach einer Viertelstunde kommt Forster zum Thema, das ihn am meisten am Herzen liegt: der Judenfrage. Seine Stimme erhebt sich jetzt über den Lärm des Regens, der auf das Dach trommelt.
„Danzig darf in Zukunft nicht mehr ein Asyl für das Judentum sein!“ donnert er. „Nie wieder werden wir die Horden polnischer Juden aufnehmen, die seit Jahren in unsere Stadt strömen und sie befallen haben!“ Etwas Applaus. „Aber die Aktionen, die wir in den letzten Tagen in unserer Stadt gesehen haben, sind keine Art und Weise, mit der jüdischen Bedrohung umzugehen.“ Er schlägt mit der Faust auf das Rednerpult. „Was können ein paar zerbrochene Fensterscheiben ausrichten, um diese Frage zu lösen und den jüdischen Parasiten aus unserer Mitte zu entfernen? Wir brauchen eine angemessene, eine gründliche Lösung, und deshalb sage ich euch heute, dass die jüdische Frage in Danzig sehr bald gelöst sein wird, und das mit gesetzlichen Maßnahmen. Und auf diese Weise wird Danzig, wie in anderen Angelegenheiten, mit dem Deutschen Reich in Einklang gebracht.“
Forster beendet seine Rede. Bender und die Journalisten erheben sich von ihren Sitzen und applaudieren ausgiebig; die anderen Männer folgen.
„Haben Sie alles mit bekommen?“ fragt Forster die Journalisten, als die Männer anfangen, das Lagerhaus zu verlassen. Sie nicken.
„Ja,“ sagt einer. „Noch eine wundervolle Rede. Ich denke, wir benutzen die Überschrift …“, er schaut auf seinen Notizblock, “‘Judenfrage in Danzig wird schnellstens gelöst. Gauleiter Forster vor den Belegschaftsmitgliedern der Firma Hugo Bender, Zoppot.‘“
„Sehr gut,“ sagt Forster, und schaut auf seine Uhr. „Dann bin ich hier fertig.“
Zum Autor Joseph Cronin
Dr. Joseph Cronin ist Dozent für moderne deutsche Geschichte an der Queen Mary University of London. Derzeit interessiert er sich sehr für die Geschichte der Juden in der Freien Stadt Danzig.
–