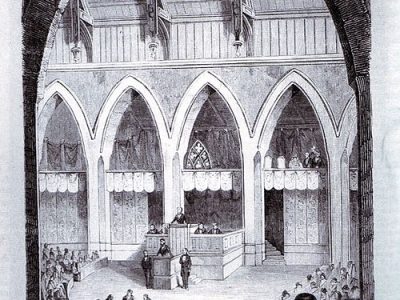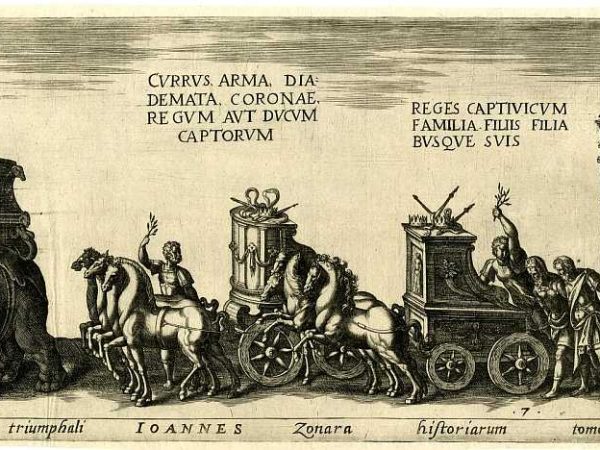Am 20. November 1975 starb in Madrid General Francisco Franco. Bis zuletzt hatte er mit diktatorischer Gewalt über Spanien geherrscht. Als neues Staatsoberhaupt und König wurde zwei Tage später Juan Carlos von Bourbon-beider Sizilien, seit 1969 offizieller Nachfolger und Kronprinz, vereidigt. Anhänger des alten Regimes erwarteten eine Fortsetzung der franquistischen Herrschaft unter veränderten Bedingungen, während die Opposition auf eine Demokratisierung hoffte. Am 15. Juni 1977 fanden zum ersten Mal seit 1936 freie Wahlen auf der Iberischen Halbinsel statt. Innerhalb von fast zwei Jahren vollzog sich beinahe unblutig eine Entwicklung, die noch zu Beginn der siebziger Jahre undenkbar schien.
Spanien unter Franco: 1939 bis 1969
1939 gingen die ›Nationalisten‹ unter der Führung von General Francisco Franco als Sieger aus dem Spanischen Bürgerkrieg hervor. Franco übernahm die Aufgaben eines regierenden Staatsoberhauptes. Dabei lavierte er am Anfang vorsichtig zwischen den verschiedenen Fraktionen der Siegerkoalition. Monarchisten, die Großgrundbesitzer, die Finanzoligarchie und die Falangisten, Anhänger einer ›national-sozialen‹ Revolution, waren sich nur einig in dem, was sie ablehnten: Demokratie, Republik, Kommunismus und die Trennung von Kirche und Staat. Außerdem bekämpften sie den baskischen und katalanischen Separatismus.
In den nächsten Jahren wurden die Fundamente für eine Diktatur gelegt. Mehrere Grundgesetze schufen die Institutionen, die bis 1977 das politische Leben bestimmen sollten. Das spanische Parlament, die Cortes, wurde in eine beratende Ständeversammlung umgewandelt. 1945 erließ Franco ein ›Gesetz über den Volksentscheid‹, das ihm die Möglichkeit gab, einzelne Gesetzesprojekte dem Volk direkt zur Abstimmung vorzulegen. Dass im gleichen Jahr erlassene ›Grundgesetz der Spanier‹ enthielt zwar einzelne Grundrechte, doch es handelte sich nicht um Abwehr- oder Teilhaberechte wie in demokratischen Verfassungsstaaten, sondern um staatliche Rechtsgewährungen im Rahmen der franquistischen Herrschaft. Mit dem ›Gesetz über die Prinzipien der Nationalen Bewegung‹ aus dem Jahr 1958 entstand das wohl wichtigste Staatsgrundgesetz. Wie eine ›Ewigkeitsklausel‹ sollten der Katholizismus als Staatsreligion, die monarchische Staatsform und das ständestaatliche Prinzip unantastbare Grundpfeiler der staatlichen Ordnung bleiben. Beim Übergang von der Diktatur zur Demokratie spielte das Gesetz aus dem Jahr 1958 eine wichtige Rolle; es war eine Hürde, die umgangen werden musste, wenn die Öffnung auf evolutionärem Wege gelingen sollte. Militär, Kirche und Falange sollten in den nächsten Jahrzehnten die Stützen der Diktatur sein. Die Falange wurde von Franco geschickt entpolitisiert. Unter dem Namen ›Nationale Bewegung‹ entwickelte sie sich zu einem bürokratischen Apparat, in dem junge Franquisten ihre Karriere beginnen konnten. Die sozialrevolutionären Ansätze gerieten in Vergessenheit.
Im Zweiten Weltkrieg blieb Spanien neutral. In den ersten Jahren nach 1945 gab es internationalen Druck auf die Diktatur. Aber schon zu Beginn der fünfziger Jahre wurde die strategische Bedeutung der Iberischen Halbinsel deutlich. Das Land konnte in den USA und Westeuropa Kredite aufnehmen. Im ›Kalten Krieg‹ erschien Franco und sein antikommunistisches Regime plötzlich als nützlicher Partner, auch wenn Spanien nicht der NATO beitrat. Am Ende der fünfziger Jahre beendete das Regime den Versuch, durch eine autarke Wirtschaftspolitik unabhängig zu werden. Seit den frühen sechziger Jahren kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der das Land nachhaltig verändern sollte. Mit einer Rahmenplanung griff der Staat in die Wirtschaft ein. Zwischen 1961 und 1974 erreichte das Land ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 7 Prozent jährlich. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt sank deutlich. Spanien schaffte den Sprung vom Entwicklungsland zur 10 größten Industrienation der Erde.
Diese Entwicklungen blieben nicht ohne Einfluss auf Staat und Gesellschaft. Innerhalb des Regimes kam es zu einem Generationenwechsel. Die ›alten Veteranen‹ des Bürgerkrieges traten allmählich ab. In die Schlüsselstellungen, vor allem in den Ministerien, rückten junge Menschen nach, die teilweise im Ausland studiert hatten und sich dort davon überzeugen konnten, dass Demokratie nicht automatisch zum Chaos führt. Die Einbindung Spaniens in die westliche Wirtschaftswelt führte bei einem Teil dieser jüngeren Entscheidungsträger zu der Erkenntnis, dass auf Dauer politische Reformen nicht zu umgehen waren. Der Tourismus und die Arbeitsemigration nach Westeuropa sorgten ebenfalls für eine Öffnung. Spanien befand sich aber keineswegs auf dem schnurgeraden Weg in eine liberalere Zukunft. Das Regime glich am Ende der Sechziger einer Burg, deren Fundamente erste Risse zeigten und deren Mauern an einigen Stellen bröckelten, aber der Burggraf und seine Soldaten hielten auf den Zinnen Wacht und schlugen zu, sobald sich ein Gegner zeigte.
Die Konflikte spitzen sich zu: 1970 bis 1976
Zu Beginn der siebziger Jahren schritt die Politisierung der Öffentlichkeit voran. Dabei waren keineswegs alle Spanier Gegner der Diktatur. Immer wieder konnte Franco einem Teil der spanischen Gesellschaft einhämmern, Demokratie würde zu Chaos, Kriminalität, Pornografie und letztlich zum Verlust des mittlerweile erreichten Wohlstands führen. Dass in den Vorzimmern franquistischer Würdenträger die Sekretärinnen mittlerweile Minirock trugen, mag banal erscheinen, verdeutlich aber auf einfache Weise die Widersprüche, in die sich das System verstrickte. In Wirtschaft und Gesellschaft vollzogen sich Entwicklungen, die auch mit einer gelenkten Presse, einem regierungsnahen Staatsfernsehen und einer franquistischen Einheitspartei nicht gesteuert werden konnten.
Innerhalb des Regimes begann die Vorbereitung für die Zeit nach Franco. Vertreter eines strikt antireformerischen Kurses fühlten sich durch die wachsende Zahl politischer Attentate und Streiks in ihrer Auffassung bestätigt, dass eine vorsichtige Liberalisierung zum Umsturz führen würde. Jene Gruppe von Franco-Anhängern, die hingegen für eine politische Öffnung eintraten, befanden sich zu Beginn der siebziger Jahre in der Defensive. Dafür begann in der katholischen Kirche ein vorsichtiger Prozess der Distanzierung vom System. Skandale innerhalb der franquistischen Führungsschicht, die Zunahme wilder Streiks und der Terror der ETA im Baskenland beherrschten zwischen 1970 und 1976 die Atmosphäre. 1970 fand im baskischen Burgos ein aufsehenerregender Prozess gegen Aktivisten der ETA statt. Die Angeklagten berichteten von Folterungen; die Möglichkeiten der Verteidigung wurden noch stärker als sonst eingeschränkt. In Europa und Lateinamerika kam es zu Protestdemonstrationen vor spanischen Auslandsvertretungen. Teile des Klerus solidarisierten sich mit den Angeklagten. Das Regime reagierte mit einer Verschärfung des Strafrechts. Anhänger Francos forderten in der Öffentlichkeit ein härteres Auftreten von Polizei und Militär im Baskenland. Der ›Burgosprozess‹ endete letztlich mit einer Niederlage des Regimes. Die vom Gericht ausgesprochenen Todesurteile wurden im Gnadenwege aufgehoben. Ein weiteres Problem für die Diktatur bestand in der zunehmenden Bereitschaft der Arbeiter zum Streik. Die regimenahen offiziellen Gewerkschaften fanden immer weniger Anklang. Die wachsende Militanz der Industriearbeiterschaft konnte auch mit Unterdrückungsmaßnahmen nicht entschärft werden.
Vor dem Hintergrund dieser innenpolitischen Konflikte signalisierte Franco am Ende des Jahres 1972 ein gewisses Einlenken: In einer Fernsehansprache erwähnte er die »Legitimität unterschiedlicher Ideen und Tendenzen«. Sein Vize-Regierungschef, Admiral Carrero Blanco, schlug Anfang März 1973 die Zulassung politischer Vereinigungen vor, die auch der systeminternen und der gemäßigten Opposition die Möglichkeit zur offiziellen Betätigung bieten sollte. Neben die falangistische Rechte wäre ein technokratisches Zentrum und eine christdemokratische Gruppe getreten. Von echten Parteien oder gar einem pluralistischen Mehrparteiensystem konnte keine Rede sein. Als Franco am 8. Juni 1973 die Ernennung Carreros zum Vorsitzenden des Ministerrates bekannt gab, bildete der Admiral ein Kabinett, in dem die Gegner von Reformen wieder eine starke Rolle spielten. Innerhalb der spanischen Regierung wuchs der Einfluss der Ultrarechten. Die Ermordung Carreros am 20. Dezember 1973 durch die baskische Separatistenorganisation ETA verstärkte ihren Einfluss noch.
Sein Nachfolger Arias Navarro bekannte sich zwar zu einer Modernisierung der Diktatur, aber selbst vorsichtige Reformschritte scheiterten am Widerstand der Falken im Regierungsapparat. Franco war schwer erkrankt und griff nur noch ganz selten in die Tagespolitik ein. Nach seinem Tod folgte ihm der Bourbone Juan Carlos am 22. November 1975 auf den Thron. Die Proklamation durch die franquistischen Cortes sollte dem Monarchen zeigen, in welchen Bahnen er sich zu bewegen habe. Er bestätigte Navarro in seinem Amt, der ein neues Kabinett bildete, in dem erstmals auch Politiker der gemäßigten Opposition saßen. Ein grundlegender Wandel der politischen Institutionen blieb aus. Da tauchte Anfang Juli 1976 ein neuer Ministerpräsident auf der Bühne auf: Adolfo Suarez.
Der Übergang zur Demokratie: 1976 bis 1977
Der neue Mann war außerhalb Spaniens kaum bekannt. Adolfo Suarez, Jahrgang 1932, hatte im Regime Karriere gemacht. Er galt als charmant, kontaktfreudig und opportunistisch. Ein gut aussehender Jurist Anfang 40, der aber in der Politik bis dahin keine nennenswerten Spuren hinterlassen hatte. Was also bewog den spanischen König, im Prozess des Übergangs die Initiative zu ergreifen und gerade einen ehemaligen ›Minister der nationalen Bewegung‹ mit der Liquidierung des Regimes zu beauftragen?
Die ersten Monate des Jahres 1976 hatten gezeigt, dass nur ein konsequenter Übergang zur Demokratie die innenpolitische Krise lösen konnte. Die Politik von Arias Navarro erwies sich als unfähig, die Eskalation im Baskenland zu verhindern und die Streiks in der spanischen Industrie einzudämmen. Der König und seine Berater erkannten, dass die Zukunft der Monarchie auf dem Spiel stünde, wenn es nicht gelänge, den Erneuerungsprozess von oben zu steuern. Die USA bestärkten Juan Carlos in seinen Plänen und sagten ihm im Juni 1976 ihre Unterstützung zu. Der Handlungsspielraum des Königs war zuerst durch den Einfluss der Ultrarechten in den Institutionen des Staates begrenzt. Seit März 1976 suchte er nach einem Ersatz für Navarro. Der neue Ministerpräsident musste eine demokratische Politik glaubhaft verkörpern und sich in der Hinterzimmerpolitik der Diktatur auskennen. Er musste in der Lage sein, mit der illegalen Opposition zu verhandeln und gleichzeitig die Armee, die letzte Hoffnung der Ultrarechten, zu beschwichtigen. Das Projekt eines friedlichen Übergangs setzte außerdem voraus, dass die franquistischen Cortes ihre Selbstauflösung beschließen würden, um für ein frei gewähltes Parlament Platz zu machen.
Suarez suchte schnell den Kontakt zur noch illegalen Opposition. Mit dem Führer der Sozialisten, Felipe Gonzales, traf er sich im August 1976. Zu den Kommunisten nahm er über Mittelsmänner Fühlung auf. Im Fernsehen bekannte er sich unmittelbar nach seiner Ernennung zum Prinzip der Volkssouveränität und kündigte ein Referendum über die grundlegenden politischen Reformen sowie freie Parlamentswahlen vor dem 30. Juni 1977 an. Der neue Ministerpräsident setzte auf Schnelligkeit und seine Überzeugungskunst im persönlichen Gespräch. Im August und September 1976 erläuterte er vor Offizieren und Entscheidungsträgern der Wirtschafts- und Finanzwelt seine Pläne. Schon bald stellte sich heraus, dass Suarez seine Wandlung zum Demokraten in der Öffentlichkeit abgenommen wurde. Für viele Spanier schien er der ideale Politiker zu sein, dem es gelingen könnte, den Franquismus zu überwinden, ohne dass es zu einem Putsch der Armee oder zu einem neuen Bürgerkrieg käme. Die Ängste vor einem Aufstand der Streitkräfte waren nicht unbegründet. Während die Industriellen in der Reformpolitik des Ministerpräsidenten eine Chance sahen, warfen Offiziere Suarez vor, seinen Eid auf Franco gebrochen zu haben. Da der Übergang zur parlamentarischen Monarchie in Übereinkunft mit den geltenden Staatsgrundgesetzen erfolgen sollte, legte die Regierung den Cortes im November 1976 ein Gesetz vor, das eine Legalisierung von politischen Parteien und die Abhaltung freier Wahlen vorsah. Nachdem die Mitglieder der Ständeversammlung mit Mehrheit zugestimmt hatten, bestätigte eine große Bevölkerungsmehrheit das Gesetz im Dezember 1976 in einem Referendum.
Im Februar 1977 begann die Zulassung politischer Parteien. Die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) konnte erstmals seit 1939 wieder legal arbeiten. Vertreter der gemäßigten Opposition aus der franquistischen Zeit sowie ehemalige Funktionäre des Regimes hatten schon im Oktober 1976 die rechtskonservative Volksallianz gegründet. Am 9. April 1977 legalisierte Suarez auch die Kommunistische Partei, nachdem deren Parteiführung sich zur Monarchie als Staatsform und zu den spanischen Landesfarben bekannt hatte. Im Offizierskorps der spanischen Armee kam es zu wütenden Protesten, doch das Militär blieb in den Kasernen. Suarez übernahm die Spitzenkandidatur der Zentrumsunion (UCD), einer neuen Partei der Mitte, deren Spektrum von gemäßigten Sozialdemokraten über die Liberalen bis hin zu den Christdemokraten reichte.
Am Abend des 15. Juni 1977 stand fest, dass die Demokratie gesiegt hatte. Stärkste politische Kraft wurde die UCD mit 34,6% der Stimmen, gefolgt von den Sozialisten mit 29,4%. Dahinter folgten mit Abstand die Kommunisten mit 9,4% und die Volksallianz mit 8,4%. Die gemäßigten Kräfte hatten sich durchgesetzt.
Fazit
Der Übergang zur Demokratie in Spanien erscheint heute als logische Konsequenz aus der Krise des franquistischen Systems. Doch bis in das Jahr 1976 hinein schien die Rechte stark genug, um ernsthafte Veränderungen zu verhindern. Mehrere Gründe trugen dazu bei, dass Spanien ein Jahr darauf in den Kreis der europäischen Demokratien eintrat.
Der König war entschlossen, die Diktatur zu beenden. Obwohl er von Franco 1969 bei seiner Ernennung zum Thronfolger auf die Grundgesetze des Franquismus verpflichtet worden war, erkannte er schnell, dass dieses System auf Dauer keine Zukunft hatte.
Die Ernennung von Adolfo Suarez im Juli 1976 erwies sich als Glücksgriff. Suarez verstand es, das Projekt einer Umgestaltung durch die Institutionen zu bringen und gleichzeitig Kontakte zur illegalen linken Opposition aufzubauen. Die Zulassung der Kommunisten war ein Coup, der einem anderen Politiker wohl die Karriere gekostet hätte, aber er gelang und stellte einen wichtigen Schritt zur Demokratisierung dar. Freie Wahlen im Juni 1977 ohne die Kommunisten hätten ein Legitimationsdefizit für das neue Parlament bedeutet.
Sozialisten und Kommunisten trugen 1976/77 ebenfalls zum Erfolg bei. Als zu Beginn des Jahres 1977 neofranquistische Extremisten vier kommunistische Anwälte ermordeten, mahnte die Parteiführung der spanischen Kommunisten zur Besonnenheit. Die Trauerfeierlichkeiten wurden zu einer beeindruckenden Demonstration ihrer Stärke und Disziplin. Suarez wiederum bewies, dass sein Wandel zum Demokraten nicht nur eine Fassade war und führte die Gespräche mit dem Zentralkomitee trotz des Widerstands aus den Reihen der Militärs weiter. So entwickelte sich 1976/77 eine neue Kultur des Dialogs über die Lager hinweg. Linke und Rechte suchten nach politischen Lösungen, was am Ende der Zweiten Republik im Jahr 1936 nicht mehr möglich gewesen war. Vielleicht lag es auch daran, dass der grausame Bürgerkrieg und seine Folgen im Gedächtnis vieler Spanier haften geblieben war. Die Hauptakteure wie Juan Carlos, Adolfo Suarez oder der Sozialist Felipe Gonzales waren davon überzeugt, dass die Konfrontation der ›beiden Spanien‹ (hie republikanisch, laizistisch, urban, demokratisch – dort monarchistisch, katholisch, ländlich, autoritär) sich nicht wiederholen dürfe.
Sozialisten und Kommunisten wussten, dass es keine Massenbasis für den Sturz des Systems gab. So sehr die Militanz sich bei Arbeitskämpfen und im Baskenland steigerte, zur Politik der Übereinkunft mit den reformbereiten Teilen des Regimes gab es keine Alternative. Suarez wiederum nutzte 1976 den steigenden Druck der Öffentlichkeit, seine ehemaligen Weggefährten dazu zu bringen, freiwillig auf die Macht zu verzichten. Gleichzeitig bot er nicht wenigen Anhängern des alten Regimes in der Zentrumsunion eine neue politische Heimat und damit eine Fortsetzung ihrer Karriere. Darin liegt sicher eine Schwäche des friedlichen Übergangs. Eine Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur blieb lange Zeit aus.
1978 wurde – wieder im Konsensverfahren – eine demokratische Verfassung verabschiedet. Suarez leitete auch den Bruch mit dem Zentralstaat ein und begann eine Politik, die dazu führte, dass das Baskenland und Katalonien mehr Eigenständigkeit erhielten. Ab 1980 zerfiel seine Macht in der heterogenen Zentrumsunion. Ende Januar 1981 erklärte Suarez seinen Rücktritt. 1982 gewannen die Sozialisten die Parlamentswahlen. Die konservative Volksallianz wurde stärkste Oppositionspartei und akzeptierte ihre neue Rolle. Spaniens Demokratie war erwachsen geworden.