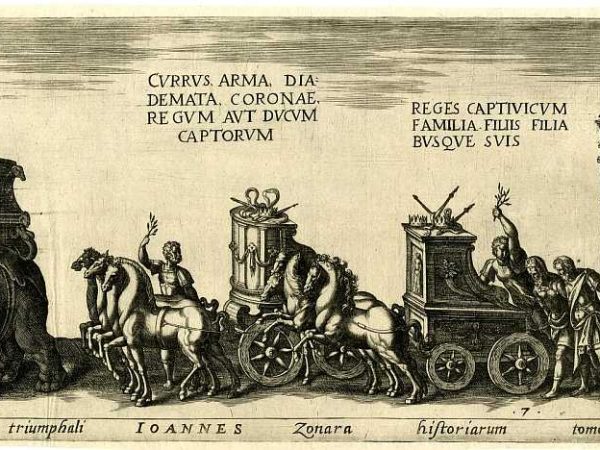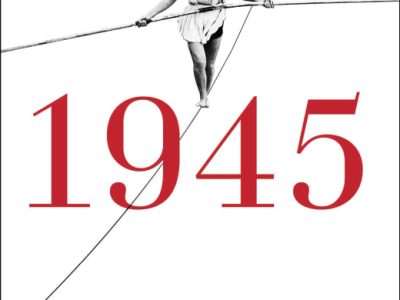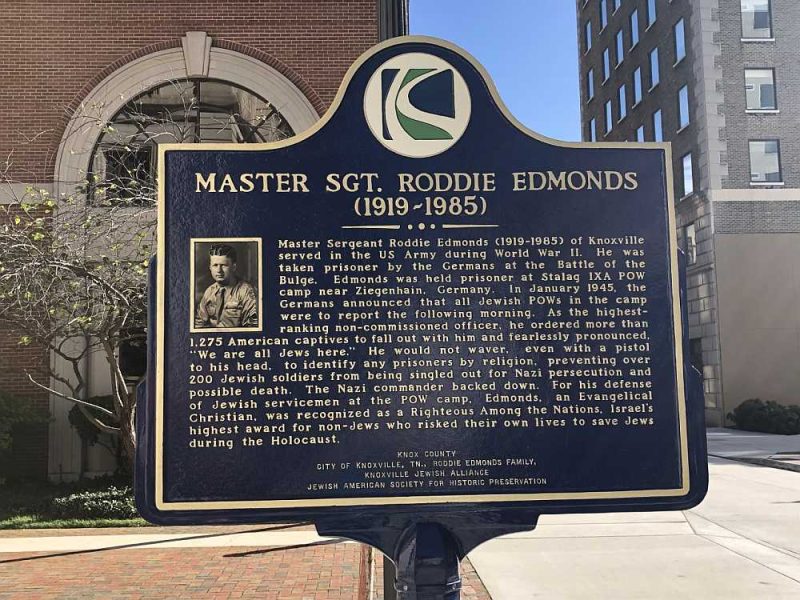Die Erde lebt. Die Gebirge der Erde, die aus dem Weltraum betrachtet wie die Runzeln eines Apfels aussehen, bezeugen, dass die Erde kein toter Planet ist, sondern sich ständig verändert. Die Kräfte aus dem Erdinnern brechen die Erdkruste immer wieder auf.
Die Erde lebt. Die Gebirge der Erde, die aus dem Weltraum betrachtet wie die Runzeln eines Apfels aussehen, bezeugen, dass die Erde kein toter Planet ist, sondern sich ständig verändert. Die Kräfte aus dem Erdinnern brechen die Erdkruste immer wieder auf.Einer der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zu dieser Erkenntnis wurde am 6.Januar 1912 gesetzt, als der Meteorologe, Astronom und Polarforscher Alfred Wegener im Senckenberg-Institut in Frankfurt sein Werk “Neue Ideen über die Herausbildung der Grossformen der Erdrinde auf geophysikalischer Grundlage” der Öffentlichkeit vorstellte. Hinter diesem sperrigen Titel verbarg sich eine revolutionär neue These zur Geschichte der Oberflächenformen der Erde.
Schon seit den grossen Entdeckungsfahrten des 16. Jahrhunderts fiel den Geographen die Ähnlichkeit der atlantischen Küstenlinien Südamerikas und Afrikas auf. Sie schienen zueinander zu passen wie zwei gigantische Puzzlestücke. 1620 äusserte Sir Francis Bacon die Vermutung, dass das “kein bloss zufälliges Faktum” sein könne. Doch bis ins 18. Jahrhundert hinein wagte es kaum jemand, die Autorität der Kirche in Frage zu stellen und eine Erklärung für die Gestalt der Erde zu suchen, die dem Schöpfungsbericht der Bibel widersprach.
Benjamin Franklin formulierte 1782 als erster den Gedanken, dass die Erde unter der festen Kruste glutflüssig sei. „Heftige Bewegungen“ im Erdinnern hätten die Kruste zerbrochen und so zu den heutigen Oberflächenformen geführt.
Alexander von Humboldt entdeckte auf seiner Südamerikareise vor fast 200 Jahren, dass nicht nur die Küstenlinien Südamerikas und Afrikas überraschend gut ineinander passen, sondern dass auch geologische Formationen an der einen Küste enden und sich auf der anderen Seite des Atlantik fortsetzen.
James Dwight Dana, Professor für Geologie und Naturgeschichte in Yale, war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der führende Vertreter der sogenannten „Kontraktionstheorie“. Er glaubte, dass die irdischen Gebirge bei der Abkühlung und Schrumpfung der frühen Erde entstanden wären. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden nur wenige Modelle zur Entstehung der Oberflächenformen der Erde entworfen, die Danas Theorie widersprachen. Alfred Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung war das bei weitem folgenreichste Alternativmodell.
Wegener las 1910 als Dozent an der Universität Marburg einen Artikel zur Erdgeschichte, der ein mit Danas „Kontraktionsmodell“ verwandtes Modell behandelte. Für Alfred Wegener allerdings stand bald fest, dass diese Theorien in die falsche Richtung gingen. Zu viel sprach in seinen Augen dagegen: Die schiere Breite des Atlantik, das unterschiedliche Alter der irdischen Gebirgssysteme und ihre ungleiche Verteilung über den Globus machte es für Wegener wahrscheinlicher, dass die Kontinente mobil sind und im Laufe der Zeit ihre Lage verändern. Seine aus dieser Erkenntnis entwickelte Theorie der Kontinentalverschiebung wird deshalb zu den sogenannten “Mobilistischen Theorien” gezählt, im Unterschied zu den „Fixistischen Theorien“ wie die Kontraktionstheorie.
Alfred Wegener wurde am 1.November 1880 als jüngstes Kind eines protestantischen Geistlichen in Berlin geboren. Er begann seine wissenschaftliche Laufbahn als Astronom, doch kam er schon bald nach seiner Dissertation zu dem Schluss, dass „in der Astronomie (…) alles im wesentlichen schon bearbeitet (war).“ Er wandte sich daher von der Astronomie ab und der Meteorologie zu.
1906 unternahm Wegener seine erste Grönlandexpedition. Im gleichen Jahr hatte Wegener auch ersten Kontakt mit dem berühmten Meteorologen Wladimir Köppen. Später heiratete Wegener die Tochter Köppens. Sein Schwiegervater war einer der wenigen Wissenschaftler, der Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung unterstützte.
Im Lauf der Zeit erarbeitete Wegener sich Kompetenz in fast allen Fachbereichen der Geowissenschaften. Er hatte eine Abneigung gegen mathematische, schwerverdauliche Abhandlungen. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse erlangte er lieber auf intuitivem Weg.
Seit 1909 war Wegener Privatdozent für Meteorologie an der Universität Marburg.
Nachdem Wegener in der Universitätsbibliothek von Marburg einmal auf die Theorien zur Erdgeschichte gestossen war, liess ihn das Thema nicht mehr los. Er erarbeitete eine schlüssige Theorie, nach der sich die Kontinente verschoben haben. Seine Erkenntnis: Fossilien beweisen, dass zwischen den Kontinenten einst Verbindungen bestanden haben müssen. Da Landbrücken aber nicht spurlos verschwunden sein können, bleibt nur die Möglichkeit, dass die Kontinente früher direkt verbunden waren und sich seitdem voneinander entfernt haben.
1912 trat er mit seiner Theorie erstmals an die Öffentlichkeit. In einem Vortrag vor der Hauptversammlung der Geologischen Vereinigung in Frankfurt erläuterte er seine neuen Ideen. Drei Jahre später veröffentlichte Wegener eine genauere Ausarbeitung seiner Kontinentalverschiebungstheorie unter dem Titel “Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”. Bis 1929 erschienen noch drei Auflagen, die jedes Mal ergänzt und verbessert wurden.
Nach Wegener verhalten sich die Kontinente ähnlich wie Eisberge: Sie schwimmen auf dem Material der Ozeanböden und können ebenso wie Eisberge zerbrechen und in verschiedene Richtungen auseinandertreiben. Wegener erkannte auch, dass die geologischen Grenzen der Kontinentalplatten nicht die heutigen Küsten, sondern die Ränder der Kontinentalschelfe sind, die meist einige hundert Kilometer vor der Küste im Meer liegen. Er rekonstruierte daraufhin einen einzigen Urkontinent, den er Pangäa (deutsch: “All-erde”) nannte. Die heutigen Kontinente sind Bruchstücke dieses Urkontinents.
Wegener war nicht der erste, der solche Theorien entwickelte. Aber er war der erste, der Beweise für seine Ideen suchte und fand.
Versteinerte tropische Pflanzen wurden in Spitzbergen gefunden, weit nördlich des Polarkreises. In Indien und Südafrika wurden Spuren alter Vergletscherung entdeckt. Das brasilianische Bergland und das Bergland des Kongo gehören eindeutig zur selben geologischen Formation, ebenso die Amazonasebene und Oberguinea in Afrika. All diese Funde waren nur dann sinnvoll zu interpretieren, wenn sich die Kontinente in der Vergangenheit verlagert hatten.
Zusammen mit seinem Schwiegervater Köppen sammelte Wegener dieses Beweismaterial. 1922 wagte er sich dann an die Rekonstruktion der Lage aller Kontinente vor 300 Millionen Jahren.
Wegener hatte mit seiner Theorie nicht nur eine schlüssige Erklärung für die Gestalt und Verteilung der Kontinente gefunden. Er glaubte auch, die Entstehung von Gebirgen erklären zu können. Er legte dar, dass ein durch ozeanische Kruste pflügender Kontinent eine “Bugwelle” in Form von Gebirgen vor sich her schieben müsste. Heute wissen wir, dass der Prozess der Gebirgsbildung erheblich komplizierter abläuft, und dass sich vor allem die Kontinente nicht aus eigener Kraft fortbewegen können. Stattdessen werden sie gezogen – in den Subduktionszonen der Erde verschwinden Platten im Erdinnern, weil sie zu schwer geworden sind, um auf dem Erdmantel zu schwimmen. An ihrer Rückseite bilden sich Aufbruchszonen, an denen neues Mantelmaterial nachquillt – so entstehen die sogenannten Mittelozeanischen Rücken.
Nicht nur wegen seiner Irrtümer fand Wegeners Theorie bei Kollegen nur wenig Anklang.
Wegener konnte auch keine plausiblen Antriebskräfte für die Verschiebung ganzer Kontinente angeben. Weder die von der Erdrotation erzeugte Zentrifugalkraft noch die Gezeitenkräfte von Sonne und Mond boten überzeugende Konzepte. 1929 erwähnte Wegener in der vierten Auflage seines Buches eine weitere mögliche Antriebskraft für die Kontinentalverschiebung: Konvektionsströmungen im glutflüssigen Erdinneren. Doch er baute diesen Gedanken nicht weiter aus. Heute wissen wir: Diese Strömungen sind tatsächlich der Motor der Plattentektonik.
Die 1922 ins Englische, Französische, Spanische und Russische übersetzte dritte Auflage von Wegeners Buch “Die Entstehung der Kontinente und Ozeane” erzeugte heftigste Reaktionen unter den etablierten Geologen. Viele weigerten sich einfach, Wegeners Theorie anzuerkennen, weil sie bedeutete, dass sie „alles vergessen (mussten), was in den letzten 70 Jahren gelehrt worden ist, und ganz von vorn anfangen.“
Durch solche Angriffe wurde Wegeners Karriere empfindlich gestört. Lange erhielt er keinen Ruf auf eine ordentliche Professur an einer deutschen Universität. Erst 1924 wurde er an die Universität Graz auf den Lehrstuhl für Meteorologie und Geophysik gerufen. Hier konnte er seine meteorologischen Forschungen mit der Weiterentwicklung der Kontinentalverschiebungstheorie verbinden.
Doch schon 1930 starb er auf seiner dritten Grönlandexpedition. Auf der Suche nach dem verschollenen Forscher fand man nur sein Grab. Von seinem Begleiter fehlte jede Spur. Durch seinen frühen Tod konnte Wegener seine Gedanken zur Kontinentalverschiebung nicht mehr fortführen.
Noch bis in die 60er Jahre hinein wurde Wegeners Theorie vehement bekämpft. Erst als mit der Erforschung der Mittelozeanischen Rücken die Beweislast erdrückend wurde, setzte sich die Theorie der Kontintalverschiebung durch.
Die Weiterentwicklung und Verfeinerung der Theorie Alfred Wegeners brachte die moderne Theorie der Plattentektonik hervor.
Nach dieser Theorie bewegen Konvektionsströme im Erdmantel die Platten der Erdkruste entlang von Gleitschichten, die in 100 bis 200km Tiefe liegen. Diese Zone halbplastischer Schichten nennt man Asthenosphäre, die darüberliegende Kruste mit ozeanischen und kontinentalen Gesteinen die Lithosphäre.
Die Platten der Lithosphäre sind nicht identisch mit den Kontinenten, sondern zu jeder Platte gehören sowohl kontinentale als auch ozeanische Anteile. Eine Ausnahme bildet die Pazifische Platte, die grösste Lithosphärenplatte. Sie ist die einzige rein ozeanische Platte, wenn man von dem geringen Anteil an Kalifornien absieht. Die pazifische Platte spiegelt deutlich die Auswirkungen der Plattentektonik: Sie ist umgeben von Tiefseegräben, mittelozeanischen Rücken und einem Ring von Vulkanen.
An den Mittelozeanischen Rücken tritt das geschmolzene Material aus dem Erdmantel aus. Diesen Prozess nennt man Sea – floor spreading, obwohl man mittlerweile weiß, dass hier nichts gespreizt wird. Dabei entfernen sich die Platten voneinander und neues Krustenmaterial wird produziert.
Wo zwei Platten gegeneinander gedrückt werden, kollidieren sie und es bilden sich Faltengebirge wie die Alpen, gleichsam als Knautschzone.
Wenn eine Platte unter die andere geschoben wird, wird dieser Vorgang Subduktion genannt. Hier gleicht sich der Zuwachs an Krustenmaterial, der in den Mittelozeanischen Rücken produziert wird, wieder aus.
An den Subduktionszonen bilden sich Tiefseegräben. Sie werden über 10.000m tief. Solche Gräben finden sich rund um den Pazifik.
Wo zwei Platten seitlich aneinander vorbei gleiten, gibt es Blattverschiebungen wie in der kalifornischen San Andreas-Störung. Hier schrammen die pazifische und die nordamerikanische Platte aneinander vorbei und verhaken sich dabei immer wieder. Lösen sie sich mit einem heftigen Ruck wieder voneinander, gibt es ein Erdbeben.
Auch die anderen Prozesse der Plattentektonik, Kollision und Subduktion, verlaufen ruckartig, weswegen Erdbeben an allen Rändern der Lithosphärenplatten eine häufige Erscheinung sind.
Neben Erdbeben sind Vulkane die augenfälligsten Kennzeichen von Plattengrenzen.
Vulkane sind Ventile, durch die die unter Druck stehende Magma aus dem Erdinnern an die Oberfläche gelangt. Bei Vulkanausbrüchen werden auch Mineralien und Gase gefördert. Ihnen verdanken wir viele Rohstofflagerstätten und auch den natürlichen Treibhauseffekt. Er machte in der Erdgeschichte relativ stabile Temperaturen auf unserem Planeten erst möglich – eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung des Lebens.
Die genaue Kenntnis der plattentektonischen Prozesse hilft, das Aussehen der Erde in der Vergangenheit zu rekonstruieren und in die Zukunft zu projizieren.
Man hat festgestellt, dass sich die beiden Grosskontinente Gondwana und Laurasia, die es vor etwa 280 Millionen Jahren, am Ende des Karbonzeitalters, gab, zum Superkontinent Pangäa vereinigt haben. Vor etwa 220 Millionen Jahren, in der späten Triaszeit, hat Pangäa begonnen, sich wieder aufzuspalten. Dieser Prozess hält bis heute an und hat die Kontinente geschaffen, wie wir sie kennen
In der Zukunft, in etwa 100 Millionen Jahren, werden die Kontinente weiter gewandert sein. Dann wird Afrika mit Europa kollidiert und das Mittelmeer verschwunden sein. Wahrscheinlich hat sich dann auch schon Ostafrika von Afrika abgespalten und wird sich als Kleinkontinent mitten im Indischen Ozean befinden. Australien und Neuguinea werden zu einer Landmasse verschmolzen sein, der Atlantik erheblich breiter sein als heute.
Irgendwann wird sich der Atlantik dann wieder schliessen und die beiden amerikanischen Kontinente wieder auf Europa und Afrika zuwandern. In ungefähr 250 Millionen Jahren werden sich dann alle Kontinente wieder zu einem Superkontinent vereinigt haben.
Dieser Prozess der Aufspaltung und Wiedervereinigung eines Superkontinents wird nach dem kanadischen Geologen J.Tuzo Wilson (1908-1993) Wilson—Zyklus genannt und dauert ca. 500 Millionen Jahre.
Mit den Informationen aus der Erdgeschichte kann die Plattentektonik konkrete Vorgaben für Forschung und Industrie liefern.
Bergbaufirmen können neue Lagerstätten von Bodenschätzen finden und es können Frühwarnsysteme für Regionen entwickelt werden, die durch Vulkanismus oder Erdbeben bedroht sind. Auch für die Auswahl von Endlagerstätten für Abfälle, die auch in Jahrtausenden noch ein hohes Gefahrenpotential besitzen, ist es wichtig, die geologischen Gegebenheiten vor Ort genau zu kennen.
Ohne die von Alfred Wegener erkannte Mobilität der Kontinentalplatten wäre die Erde ein toter Planet. Mit der zunehmenden Fülle an Daten, die in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt wurden, verbessert sich auch unser Verständnis von den Vorgängen im Innern der Erde. Alfred Wegeners Theorie der Kontinentalverschiebung und das daraus entstandene Modell der Plattentektonik können viele Fragen beantworten, doch was in der Tiefe unter unseren Füssen wirklich vor sich geht, kann auch heute noch nicht endgültig festgestellt werden. Aber mit jeder neuen Information, die sie der Erde entringen, kommen die Geologen diesem Ziel ein bisschen näher.