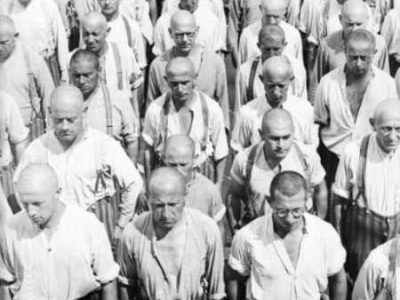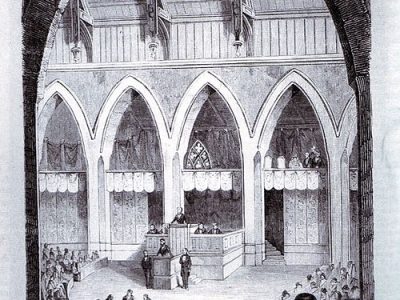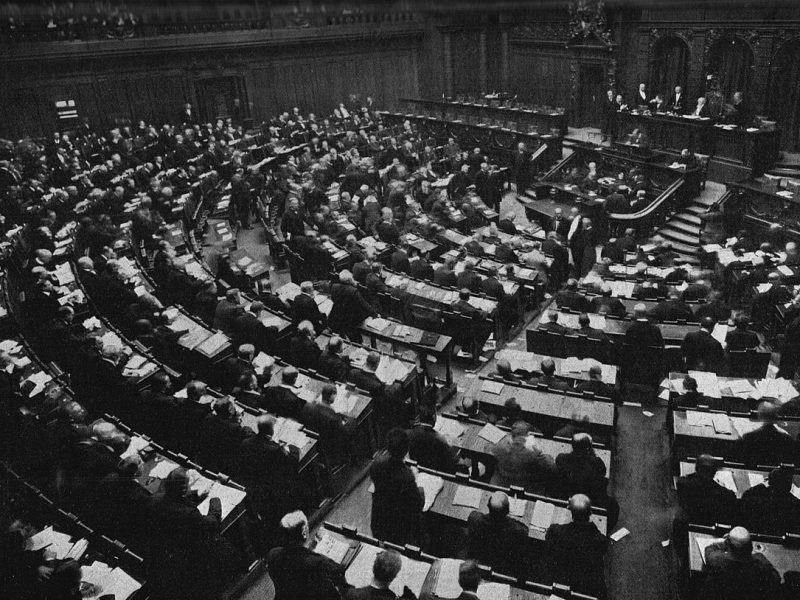Die NPD (Nationaldemokratischen Partei Deutschlands) wurde 1964 in Hannover gegründet und ging insbesondere aus der zw. 1950-1965 bestehenden rechtskonservativen DRP (Deutsche Reichspartei) hervor, aber auch aus der nationalkoservativen Deutschen Partei (DP) sowie aus mehreren Kleingruppen, wie der Vaterländischen Union, kamen Mitglieder und Funktionäre zur NPD.
Bald nach der Gründung der Partei stellten sich die ersten Wahlerfolge ein. So erreichte die NPD bereits 1966 in den Landtagswahlen in Bayern 7,4 % und in Hessen 7,9 % und zog damit in beide Landtage ein. Auch in Hamburg erreichte die Partei mit 3,9 % ein beachtliches Ergebnis, scheiterte hier aber an der Sperrklausel. In den beiden folgenden Jahren setzten sich die Erfolge der Partei fort und zog in weitere Landtage ein – so 1967 in Bremen (8,8 %), Niedersachsen (7,0 %), Rheinland-Pfalz (6,9 %) und Schleswig-Holstein (5,8 %) sowie 1968 in Baden-Württemberg (9,8 %). In der Bundestagswahl im Jahre 1969 scheiterte die NPD mit 4,3 % nur relativ knapp an der 5 % – Sperrklausel.
Nach diesem furiosen Beginn riss die Erfolgsserie fürdie NPD ab, und konnte für längere Zeit in keiner weiteren Landtags- oder Bundestagswahl mehr die Sperrklausel erreichen. Erst nach der Einheit Deutschlands kam es erneut zu Wahlerfolgen für die NPD. So zog die NPD 2004 mit 9,2 % in den Landtag in Sachsen ein und erreichte im Saarland 4,0 %. In Sachsen konnte die NPD 2009 mit 5,6 % erneut, aber mit Verlusten in den Landtag einziehen.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern gelang der NPD im Jahre 2006 mit 7,3 % der Einzug in den Landtag – im Jahre 2011 mit 6,0 % erneut. Auch in weiteren Bundesländern erreichte die NPD relativ hohe Wahlergebnisse – so 2009 in Thüringen (4,3 %) und 2011 in Sachsen-Anhalt (4,6 %).
Am 12. Dezember 2010 beschloss ein Parteitag der DVU eine Fusion mit der NPD, die am 1. 1. 2011 vollzogen wurde. Aufgrund eines Rechtsstreits wurde die Fusion erst am 26. Mai 2012 endgültig rechtskräftig. Nach dieser Fusion nannte sich die Partei zunächst „NPD – Die Volksunion“, heute jedoch wieder NPD. In den Jahren davor hatte es bereits bei Wahlen eine Zusammenarbeit beider Parteien im sogenannten „Deutschlandpakt“ (2002–2009) gegeben.
Trotz der Fusion stellte das Verwaltungsgericht Berlin im August 2012 fest, dass die NPD nicht Rechtsnachfolgerin der DVU ist.
Die NPD heute:

Die NPD hat heute (2013) eine Mitgliederzahl von etwa 5000 – deren Jugendorganisation, die Jungen Nationaldemokraten (JN), etwa 400.
Daneben verfügte die Partei bis 1990 über einen eigenen Studentenverband [Nationaldemokratischer Hochschul-Bund (NHB)], eine bundesweite Frauenorganisation [Ring Nationaler Frauen (RNF) – 2006 gegründet] und verschiedene Parteizeitungen.
Schaut man sich das Parteiprogramm der NPD an, dann stellt man fest, dass es vor allem auf nationalem Egoismus aufgebaut ist und die Unterschiede der Völker besonders hervorhebt. Einwanderung soll gestoppt werden um eine „Überfremdung“ Deutschlands zu verhindern. Ausländer will die NPD aus der Gesellschaft ausgrenzen und aus Deutschland ausweisen. Um dies zu rechtfertigen, greift die NPD auf das Abstammungsprinzip zurück, nach der man Deutscher ausschließlich durch Geburt ist und nicht durch Einbürgerung werden kann. Die Integration von Migranten betrachtet die NPD gar als „menschenfeindlich“ und als „Völkermord“. Auch richtet sich die NPD gegen eine Islamisierung Deutschlands, die sie als „Gefahr“ ansieht. Das Recht auf Asyl will die NPD abschaffen. Zudem tritt die NPD für den Austritt Deutschlands aus der EU und der NATO und gegen die Globalisierung ein.
Die NPD sieht die Grenzen Deutschlands, die im Ergebnis des 2. Weltkrieges entstanden sind, als unrechtmäßig an und will die Konflikte, die sie in diesem Zusammenhang sieht, „…auf friedlichem Wege (…) lösen“. Der 8. Mai 1945 ist für die NPD kein „Tag der Befreiung“ und daher kein Anlass zu feiern.
Bereits 2001 versuchte die Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), die NPD durch ein Verbotsverfahren verbieten zu lassen. Dazu wurde am 30. Januar 2001 ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht. Am 30. März 2001 folgten Bundestag und Bundesrat mit eigenen Verbotsanträgen. Jedoch wurden die Verfahren vom Bundesverfassungsgericht am 18. März 2003 aus Verfahrensgründen eingestellt, weil V-Leute des Verfassungsschutzes auch in der Führungsebene der Partei tätig waren. Die Frage, ob es sich bei der NPD um eine verfassungswidrige Partei handelt, wurde dabei nicht einmal geprüft – ein für die demokratischen Parteien niederschmetterndes Ergebnis.
Im Dezember 2012 beschloss der Bundesrat, ein erneutes Verbotsverfahren gegen die NPD beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Die Politiker der Länder meinen genügend Beweise vorlegen zu können, das ein solches Verfahren rechtfertigt. Das Vorhaben des Bundesrates ist deswegen so bedeutungsvoll, weil zum einen bereits ein Verbotsantrag gegen die NPD an Formfehlern gescheitert ist, zum anderen aber auch, weil in der bundesdeutschen Geschichte seit 1949 trotz häufigerer Versuche bisher erst zwei Verbotsverfahren erfolgreich verliefen. Diese Parteiverbote wurden in den Jahren 1952 gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ausgesprochen und liegen damit zudem schon Jahrzehnte zurück.
Doch wie schlüssig sind die Beweise tatsächlich? Das soll in einem weiteren Artikel näher beleuchtet werden.
Fortsetzung: hier klicken
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/NPD#cite_ref-150
http://de.wikipedia.org/wiki/NPD#Jugendorganisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokratischer_Hochschulbund
http://de.wikipedia.org/wiki/NPD-Verbotsverfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Parteiverbot#Deutschland
http://www.npd.de/inhalte/daten/dateiablage/br_parteiprogramm_a4.pdf