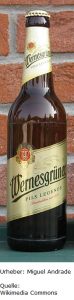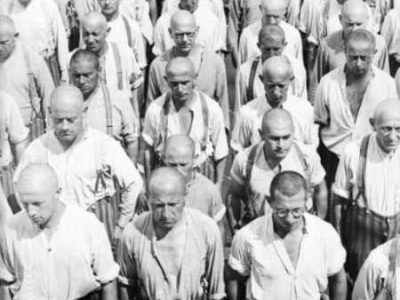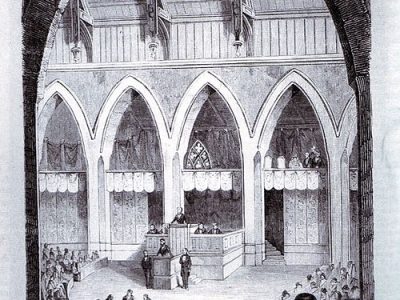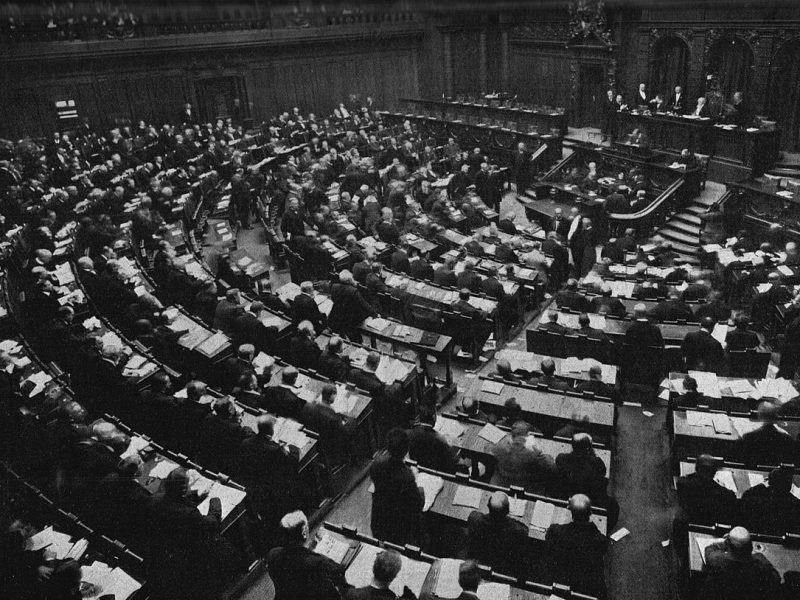Das heute noch von Bierbrauern und Biertrinkern hoch gehaltene Reinheitsgebot wurde am 23. April 1516 erstmals für das ganze damalige Herzogtum Bayern (noch nicht für das ganze Reich) durch Herzog Wilhelm IV. „der Standhafte“ (1508-1550) erlassen. Der Wortlaut dieses Erlasses klingt in heutiger Übersetzung so:
Wie das Bier im Sommer und Winter auf dem Land ausgeschenkt und gebraut werden soll
Wir verordnen, setzen und wollen mit dem Rat unserer Landschaft, daß forthin überall im Fürstentum Bayern sowohl auf dem lande wie auch in unseren Städten und Märkten, die kein besondere Ordnung dafür haben, von Michaeli bis Georgi ein Maß (bayerische = 1,069 Liter) oder ein Kopf (halbkugelförmiges Geschirr für Flüssigkeiten = nicht ganz eine Maß) Bier für nicht mehr als einen Pfennig Münchener Währung und von Georgi bis Michaeli die Maß für nicht mehr als zwei Pfennig derselben Währung, der Kopf für nicht mehr als drei Heller (Heller = gewöhnlich ein halber Pfennig) bei Androhung unten angeführter Strafe gegeben und ausgeschenkt werden soll. Wo aber einer nicht Märzen-, sondern anderes Bier brauen oder sonstwie haben würde, soll er es keineswegs höher als um einen Pfennig die Maß ausschenken und verkaufen. Ganz besonders wollen wir, daß forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Faß Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden. Wo jedoch ein Gauwirt von einem Bierbräu in unseren Städten, Märkten oder auf dem Lande einen, zwei oder drei Eimer (= enthält 60 Maß) Bier kauft und wieder ausschenkt an das gemeine Bauernvolk, soll ihm allein und sonst niemandem erlaubt und unverboten sein, die Maß oder den Kopf Bier um einen Heller teurer als oben vorgeschrieben ist, zu geben und auszuschenken.
Gegeben von Wilhelm IV.
Herzog in Bayern
am Georgitag zu Ingolstadt anno 1516 <<
Wie kam es zu dieser Verordnung?
Geschichte des Bieres
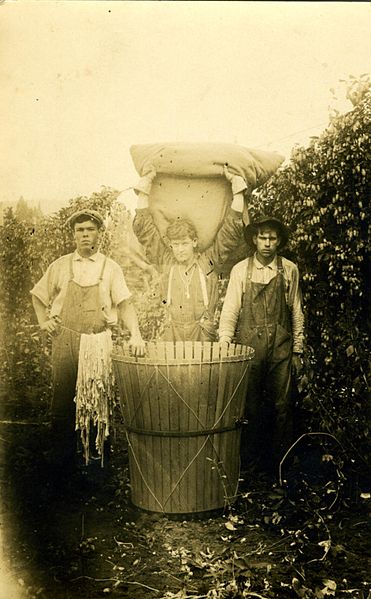
Bier ist ein schon sehr altes Getränk. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen soll es bereits mehr als 9000 Jahre alt sein und soll etwa auf die Zeit zurückgehen, als Menschen im Nahen Osten und China vor 9000 bis 10.000 Jahren vor Chr. damit begannen, Gerste und Weizen zu kultivieren. Dabei dürfte die Entdeckung des Mälzens des Getreides eher Zufall gewesen sein, denn da die Vorratslager nicht völlig wasserdicht waren, begann in Wasser eingeweichtes Getreide zu keimen und insbesondere bei Gerste entwickelten sich Enzyme, die die Stärke der Getreidekörner zu Malzzucker spalteten.
In Mitteleuropa sind bierähnliche Getränke seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. nachgewiesen. Dabei dürfte sich Bier zu einem wichtigeren alkoholischen Getränk entwickelt haben, als etwa der Met, da Getreide für das Bier sehr viel günstiger zu beschaffen war, als der Grundstoff Bienenhonig für den Met. So kannten sowohl die Kelten verschiedenen Biersorten und auch bei den Germanen erwähnt der römische Schriftsteller Tacitus in seinem Werk „Germania“ Bier als das Hauptgetränk.
Um Geschmack und Haltbarkeit zu verbessern, wurden schon früh zahlreiche Zusatzstoffe, wie Eichenrinde und Kräuter, wie Myrte, Gagel oder Johanneskraut dem Bier zugesetzt. Um den Alkoholgehalt bzw. die Rauschentwicklung zu erhöhen, wurden auch Kräuter mit bewusstseinsverändernder Wirkung, wie Bilsenkraut, Stechapfel oder Porst zugesetzt.
So war Bier auch im Mittelalter noch in vielen Gegenden das wichtigste Volksgetränk, wobei seit dem 12. Jh. der Gagel durch den Hopfen verdrängt wurde, der das Bier haltbarer und transportfähiger machte. Endgültig setzte sich das Hopfenbier erst im 16. Jh. durch.
Im Jahre 1376 produzierten allein in Hamburg 457 Brauereien Bier. In Köln – einer der wohlhabendsten Städte des Spätmittelalters – lag der pro Kopf-Verbrauch pro Jahr bei 175 bis 295 Liter (zum Vergleich: In Bayern – einem Bundesland mit relativ hohem Bierkonsum in der Gegenwart – lag der Verbrauch pro Kopf im Jahre 2007 bei durchschnittlich 155,4 l). Damit war der Bierkonsum auch bereits im Spätmittelalter für die Steuerbehörden von großem Interesse. Fast überall wurden Produktions- und Verkaufssteuern auf Bier erhoben. Zudem war Brauen und der Verkauf von Bier an bestimmte Privilegien gebunden, um zu verhindern, dass die Biersteuer umgangen wurde. In vielen Teilen des römisch-deutschen Reiches wurde das Biergeld zu einer der wichtigsten Steuerquellen.
Das erste urkundlich bekannte Braurecht wurde 974 durch Kaiser Otto II. an die Kirche zu Lüttich verliehen.
Im Zuge der Verleihung des Stadtrechts an Augsburg durch Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“ im Jahre 1156 fand in der Rechtsverordnung auch die Bierqualität Erwähnung.
In einem Erlass in Nürnberg aus dem Jahre 1303 wurde geregelt, dass zum Bierbrauen nur Gerste und kein anderes Getreide verwendet werden durfte.
Weitere Erlasse über die Inhaltsstoffe des Bieres sind u. a. für das Jahr 1348 für die Stadt Weimar (Malz und Hopfen), für das Jahr 1434 für den thüringischen Ort Weißensee („nichts anderes als Hopfen, Malz und Wasser“) sowie 1447 für München (Gerste, Hopfen und Wasser) überliefert.
In der Verordnung von 1447 für München wurden bereits genau jene Inhaltsstoffe genannt, die auch in der bayrischen Landesverordnung von 1516 Eingang fanden und damit erstmals zu Landesrecht in ganz Bayern wurde.
Hintergrund für die Brauvorschriften waren zahlreiche Klagen über schlechtes Bier. Oft reagierten Bierbrauer dabei auf die Bierpreisfestlegungen der Obrigkeit bei gleichzeitig steigenden Preisen bei den Rohstoffen mit einer schlechteren Bierqualität.
Das Reinheitsgebot von 1516 wurde später jedoch zunächst noch ergänzt. So ließ ein bayrisch-herzoglicher Erlass von 1551 als weitere Zutaten noch Koriander und Lorbeer zu, verbot aber ausdrücklich die Verwendung von Bilsenkraut und Seidelbast.
Die bayerische Landesverfassung von 1616 erlaubte außerdem noch Salz, Wacholder und Kümmel für die Bierproduktion.
Obwohl in Bayern laut der Landesverordnug von 1516 Weizen als Getreide nicht zulässig war, erhielt der Freiherr von Degenberg 1548 gegen jährliche Zahlungen das Privileg, nördlich der Donau Weizenbier zu brauen. Dieses Privileg fiel 1602 an den bayerischen Herzog zurück, als das Geschlecht der Grafen von Degenberg ausstarb. Daraufhin errichtete der Herzog mehrere Weizenbierbrauereien. Das Argument, Weizen solle mit dem bis dahin bestehenden Verbot zum Bierbrauen für die Ernährung gesichert werden, galt von dieser Zeit an nicht mehr.
Im Verlauf des 19. Jh. wurde das Verbot, andere Zutaten als Gerstenmalz und Hopfen zur Bierherstellung zu verwenden, in Bayern wieder durch verschiedene Gesetze verankert, wie etwa im Landtagsabschied vom 10. November 1861, in der Aufhebung des Biertarifs vom 19. Mai 1865 oder auch im Malzaufschlagsgesetz von 1868.
Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 haben auch andere deutsche Fürstentümer ähnliche Regelungen eingeführt. Von 1906 an galten im gesamten Reichsgebiet ähnliche Regelungen des Reinheitsgebotes – das Deutsche Biersteuergesetz (BierStG) vom 9. Juli 1923 regelte schließlich die Zutaten für Bier reichseinheitlich.
Danach waren für untergäriges Bier Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser zugelassen – für obergäriges Bier waren auch andere Malzsorten, wie Rohr-, Rüben-, Invert, Stärkezucker und daraus hergestellte Farbstoffe sowie Süßstoffe erlaubt. Von dieser Regelung ausgenommen waren Hobby- und Hausbrauer, die nur geringe Mengen Bier herstellten und besondere Biere bzw. Biere, die für den Export betimmt waren. Zudem gab es schärfere Regelungen für Brauereien in Süddeutschland.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in der Bizone (mit Ausnahme Bayerns) für eine Zeit lang auch weitere Zusatzstoffe zugelassen, wie etwa Kartoffelflocken, Zuckerrübenschnitzel, Hirse sowie Zucker.
In der DDR regelte die TGL 7764, dass neben Wasser, Hopfen und Malz auch weitere Zusatzstoffe, wie Gerstenrohfrucht, Reisgrieß, Maisgrieß Zucker, Stärkecouleur, Natriumsacharin, Pepsinkonzentrat, Milchsäure, Salz, Tannin, Kieselgelpräparate sowie Ascorbinsäure. Damit galt hier bis zur Wiedererlangung der Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 das Reinheitsgebot für das Bier nicht.
In der Bundesrepublik wurden mit dem Biersteuergesetz vom 14. März 1952 die Regelungen von 1923 neu gefasst, während in Bayern im Unterschied dazu weiterhin das „absolute Reinheitsgebot“ galt, welches auch die Verwendung von Zucker sowie von aus Zucker hergestellten Farbstoffen und von Süßstoff bei der Bereitung obergährigen Bieres ausschloss.
Am 12. März 1987 entschied der Europäische Gerichtshof aufgrund einer 1984 von der EWG-Kommission eingereichten Klage über ein in der Bundesrepublik Deutschland bestehendes Verbot, dass ausländische Biere, die nicht nach den deutschen Regeln hergestellt wurden, nicht unter der Bezeichnung „Bier“ verkauft werden durften, gegen die Warenverkehrsfreiheit des EWG-Vertrages verstieß.
1993 wurde das Biersteuergesetz (BierStG) als sogenanntes „Vorläufiges Biergesetz“ neu gefasst, wobei das Reinheitsgebot soweit gelockert wurde, dass nun die Verwendung von Hopfenextrakt und die „Schönung“ des Bieres mit Hilfe von Polyvinylpyrrolidon (bzw. Lebensmittelzusatzstoff E 1202) erlaubt war.
Dieses Gesetz wurde 2005 durch Art. 7 Nr. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts aufgehoben.
Die ebenfalls 2005 beschlossene Bierverodnung regelt, was als Bier bezeichnet werden darf – maßgeblich sind dabei die Herstellungsvorschriften nach dem Vorläufigen Biergesetz.
Hersteller von importiertem Bier sind danach nicht mehr an die Vorschriften gebunden und auch deutsche Brauereien können davon abweichen, wenn sie untergäriges Bier für den Export produzieren.
Welche Biersorten gibt es heute in Deutschland?
Es wird unterschieden zwischen untergärigen und obergärigen Bieren.
Untergärig bedeutet: mit untergäriger Hefe gebrautes Bier. Die Hefe hat dabei eine niedrige Temperatur von zw. 4 – 9 °C für die Gärung. Die Gärung benötigt eine längere Zeit und die Hefe sinkt dabei auf den Boden des Gärgefäßes – daher der Name „untergärig“.
Im Unterschied dazu benötigt die obergärige Hefe eine Umgebungstemperatur von 15-20 °C Die Gärung verläuft schneller, als beim untergärigen Bier und die Hefe schwimmt auf der Oberfläche des Jungbieres – daher: „obergärig“.
Zur Bierherstellung wird meist Gersten- oder Weizenmalz verwendet.
Der Hopfen verleiht dem jeweiligen Bier seinen charakteristischen Geschmack.
Am weitesten verbreitet ist das Pils bzw. Pilsener. Es wurde nach dem Urspungsort der Brauart, Pilsen in Böhmen benannt.
Es ist ein untergärig gebrautes Bier und hat einen Alkoholgehalt von 4,0 – 5,2%. Zum Einsatz kommt ausschließlich Gerstenmalz und sehr aromatischer Hopfen.
Im Unterschied dazu ist das sogenannte „Lager“ nur schwach gehopft, aber mit leicht erhöhtem Alkoholgehalt.
Das sogenannte „Helle“ ist ebenfalls ein untergäriges Bier, bei dem Gerstenmalz zum Einsatz kommt und das schwach gehopft ist. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 4,7 – 5,4%. Der Name „Hell“ bezieht sich dabei tatsächlich auf die hellere Farbe des Bieres, das ansonsten nach Pilsener Brauart hergestellt wird.
Das Export ist eine besondere Sorte im Sortiment der Brauereien, die oft auch als „Premium“ bezeichnet wird und meist einen Alkoholgehalt von über 5% hat.
Auch das Schwarzbier ist eine untergärig gebraute Biersorte.
Es erhält seine dunkle Farbe durch die Verwendung eines dunklen Braumalzes oder Röstmalzes. Der Alkoholgehalt liegt bei 4,8 – 5%.
Zu den sogenannten Starkbieren gehören vor allem die Bockbiere, aber auch das in Deutschland seltenere Porter.
Der Name „Bockbier“ stammt ursprünglich aus Bayern.
Der bayrisch-herzogliche Hof in München bezog sein Bier seit 1555 aus Einbeck in Niedersachsen, wo diese Biersorte ihren Ursprung hat. Einige Jahrzehnte später verlegte man das Hofbräuhaus jedoch erst auf die Landshuter Burg Trausnitz (1573) und dann nach München (1589), um das Bier selbst zu brauen.
1614 wurde der Braumeister Elias Pichler von Einbeck an das bayrische Hofbräuhaus angeworben, der fortan dort mundartlich sein „Ainpöckisch Bier“ braute. Im Laufe der Zeit schliff sich der Name zu „Bockbier“ ab.
Es gibt helle und dunkle Bockbiere, die sowohl ober- als auch untergärig sein können. Der Alkoholgehalt liegt bei etwa 6,5% oder darüber – beim sogenannten Doppelbock kann er auch bei bis zu 12% liegen.
Das Weizenbier ist heute vor allem in Süddeutschland verbreitet.
Es ist ein obergäriges Bier, bei dem Weizenmalz zum Einsatz kommt. Es ist ein helles Bier und wird daher oft auch als „Weißes“ Bier bezeichnet.
Auch Altbiere sind obergärig gebraute Biere, die insbesondere im Rheinland beliebt sind. Es sind dunkle, besonders würzige Biere mit einem Alkoholgehalt von etwa 4,8%.
Der Name „Alt“ bezieht sich auf das besondere Alter der Brauart (sprich: hergestellt „nach alter Brauart“).
Eine spezielle Sorte des Altbieres mit gesetzlich geschütztem Namen ist das Kölsch. Im Unterschied zum Kölsch sind die übrigen Altbiersorten jedoch meist herber im Geschmack.
Eine ebenfalls alte Biersorte ist das Dunkelbier. Farblich liegt es zwischen den Hell- und Schwarzbiersorten. Zu den Dunkelbieren gehören auch die alkoholschwachen Malzbiere und Karamellbiere.
Die Berliner Weiße ist ein obergärig gebrautes Bier, das durch seine spezielle Brauart leicht säuerlich schmeckt. Zur Herstellung wird Weizen- und Gerstenmalz verwendet. Das Bier hat einen relativ geringen Alkoholgehalt von 2,8% und wird mit süßem Himbeersaft bzw. -sirup oder mit Waldmeistersaft bzw. -sirup getrunken. Zur Erhöhung des Alkoholanteils wird gelegentlich auch ein Kümmel-Schnaps zugesetzt.
Na dann Prosit!