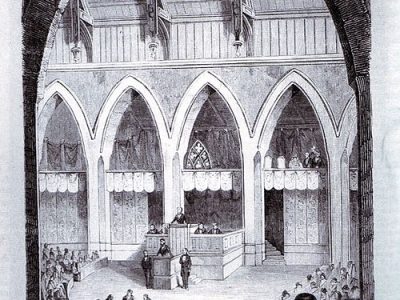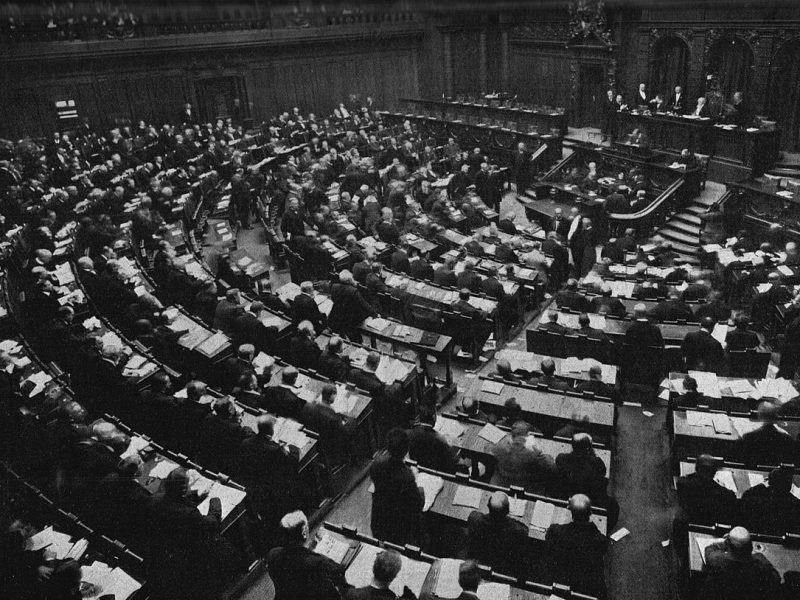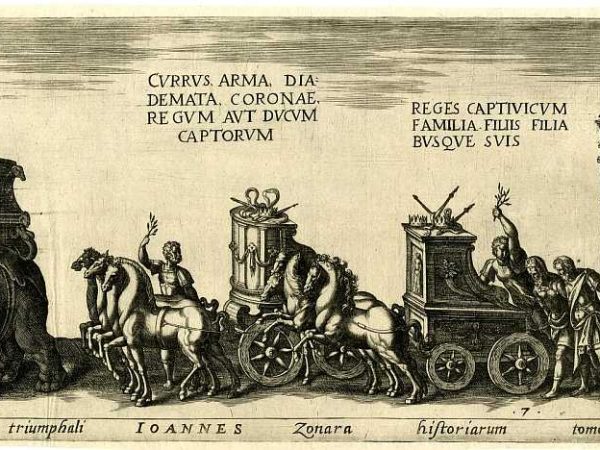Johann Krumm hieß der erste uns bekannte Homosexuelle, der ins Konzentrationslager Dachau kam. Der 31-jährige Arbeiter aus Augsburg wurde am 24. April 1933 eingeliefert, keine fünf Wochen nach Eröffnung des Lagers. Sein Vergehen: Homosexualität. Nachdem ihm dafür in der Weimarer Republik kleinere Gefängnisstrafen auferlegt worden waren, bedeutete die Einlieferung ins nationalsozialistische Konzentrationslager den Abstieg in ein System organisierter Willkür, Schikane und extremer Gewalt. Krumm war einer der ersten von tausenden Männern, denen in den Konzentrationslagern Nazi-Deutschlands die Sexualität ausgetrieben werden sollte.
Eine Opfergruppe im Schatten: Homosexuelle unter dem Hakenkreuz
Die Verfolgung homosexueller Männer ist ein Kapitel der NS-Geschichte, das auch nach Kriegsende lange ignoriert, bagatellisiert oder verzerrt wurde. Erst Jahrzehnte nach der NS-Diktatur begann eine systematische Aufarbeitung, angetrieben von einzelnen Forschenden, Aktivisten und Überlebenden. Denn: Bis 1969 blieb der von den Nazis verschärfte § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, unverändert bestehen. An einer Anerkennung und Aufarbeitung war man bis in die 1990er Jahre nicht interessiert.
Lesbische Frauen wurden im Nationalsozialismus zwar auch gesellschaftlich geächtet und in Verbindung mit anderen Verfolgungskriterien (zum Beispiel aus politischen oder rassistischen Gründen) ebenfalls festgenommen, jedoch wurden sie zumindest strafrechtlich nicht ausschließlich wegen ihrer Sexualität verfolgt. In den Augen der Nazis erschien weibliche Homosexualität im Vergleich zur männlichen als weniger bedrohlich für die so fanatisch angestrebte „Reinhaltung des Volkskörpers“. Sex und Zärtlichkeiten zwischen Männern begriff man hingegen als sich seuchenartig ausbreitende Krankheit, die etwa die Vermehrung von „Ariern“ behindere und auch die Wehrmacht zersetze. Anders als bei jüdischen Menschen war das Ziel der Nazis nicht die gänzliche Vernichtung aller homosexueller Personen, sondern die „Ausmerzung“ der Homosexualität an sich, etwa durch Kastration, Zwangsarbeit und Isolierung. Selbstverständlich kamen dabei dennoch viele Homosexuelle in den Konzentrationslagern ums Leben.
Ihre Verfolgung wurde nach Kriegsende vollständig verdrängt. Während politische Häftlinge, jüdische Menschen und andere verfolgte Gruppen bald nach dem Krieg Anerkennung als NS-Opfer erfuhren, blieben homosexuellen Männern (und anderen unter dieser Kategorie verfolgten sexuellen Minderheiten) dieser Status sowie die damit einhergehenden Entschädigungsansprüche verwehrt. In den Gedenkstätten fanden sie jahrzehntelang keine Erwähnung, ihre Leiden galten als „selbstverschuldet“. Denn nicht nur in der NS-Gesellschaft, sondern auch in der Nachkriegszeit war Homophobie ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Erst in jüngster Zeit beginnt sich ein differenzierteres Bild zu etablieren.
Die homosexuellen Häftlinge im KZ Dachau
Das am 22. März 1933 eröffnete Konzentrationslager Dachau war das erste seiner Art und bestand bis zu seiner Befreiung am 29. April 1945. Über 206.000 Häftlinge wurden hier registriert. Homosexuelle machten mit 585 gesicherten Fällen weniger als 0,5 % aus – doch diese Zahl ist irreführend niedrig. Wegen lückenhafter Dokumentation, willkürlicher Kategorisierung und vielfacher Verschleierung ist von einer höheren Dunkelziffer auszugehen. Seriöse Schätzungen, die auf Häftlingsdatenbanken Bezug nehmen, gehen davon aus, dass reichsweit insgesamt zwischen 5.000 und 15.000 Männer wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslager eingeliefert wurden, die meisten von ihnen waren Deutsche und Österreicher. Dennoch waren Homosexuelle unter den Massen an KZ-Häftlingen in der Minderheit, vor allem in den Kriegsjahren, als jüdische Menschen aus den von Deutschland besetzten Gebieten in Konzentrationslager verschleppt wurden.
Haftalltag: Isolation, Gewalt, Zwangsarbeit
Homosexuelle wurden in den Lagern entweder mit dem rosa Winkel gekennzeichnet – einem auf der Häftlingskleidung aufgenähtem rosa Dreieck – oder unter anderen Kategorien geführt: als „Berufsverbrecher“, „Asoziale“ oder „Schutzhäftlinge“. Schon ihre Ankunft im KZ war von gezielter Erniedrigung geprägt. Viele wurden gezwungen, ihre „Verbrechen“ laut vor der versammelten Häftlingsgesellschaft zu gestehen. Auf sadistische Weise wurde ihnen die eigene Sexualität zur Waffe gegen sich selbst gemacht. Ehemalige Mithäftlinge berichten von Appellen im KZ Dachau, bei denen Homosexuelle geschlagen, gedemütigt oder mit Kastration bedroht wurden. Auch sexuelle Ausbeutung gehörte für viele der Opfer zum Lageralltag. Für andere Konzentrationslager, etwa für das KZ Sachsenhausen, sind auch gezielte Mordaktionen an Homosexuellen überliefert. Zudem war das Stigma Homosexualität nicht nur seitens der SS-Wachmannschaften, sondern auch ausgehend von Mithäftlingen immer wieder Anlass für Spott und Gewalt.
Homosexuelle Häftlinge wurden in Dachau, wie auch in anderen Konzentrationslagern, isoliert – räumlich wie sozial. Auf Befehl des bayerischen Innenministeriums brachte man sie 1934 in einer eigenen, auch nachts hell erleuchteten Baracke unter. Diese Isolation machte sie zu leichten Zielen der SS. Sie galten auch unter den Häftlingen als Ausgestoßene, sodass ihre Überlebenschancen etwa im Vergleich zu politischen Häftlingen deutlich geringer waren. Die meisten anderen Gefangenen begegneten den Homosexuellen mit Misstrauen, Verachtung oder offener Ablehnung – so hatten Homosexuelle im KZ von keiner Seite die für das Überleben so wichtige Solidarität zu erwarten.
Auch in der Zwangsarbeit traf es sie besonders hart. In den ersten Jahren wurden Homosexuelle bewusst zu schwersten Arbeiten herangezogen – im KZ Dachau etwa in der Kiesgrube oder beim Ziehen der Straßenwalze –, mit dem Ziel einer angeblichen „Umerziehung durch Arbeit“. In den Kriegsjahren mussten viele von ihnen in den zahlreichen Außenlagern Dachaus für die Rüstungsindustrie schuften. Besonders gefährdet waren homosexuelle Juden, die zugleich aus rassistischen und sexualpolitischen Gründen verfolgt wurden. So wurde etwa Leopold Obermayer, ein 1934 festgenommener, jüdischer Jurist aus Würzburg, in Dachau monatelang gefoltert. Die nationalsozialistische Propaganda setzte eine Hetzkampagne gegen ihn in Gang, die neben seinem Jüdischsein auch seine Homosexualität ausschlachtete. Das Kriegsende überlebte er nicht.
In Dachau waren homosexuelle Häftlinge der SS-Gewalt in besonderer Weise ausgesetzt. Sie wurden häufiger als andere Gruppen für medizinische Experimente ausgewählt – etwa für die grausamen Malaria-Versuche des SS-Arztes Claus Schilling. Auch auf Zwangskastrationen gibt es Hinweise, in anderen Konzentrationslagern sind sie belegt. Die Chance, ein solches Martyrium zu überleben, war gering – dabei hat Dachau mit etwa 40 % eine höhere Überlebensquote unter homosexuellen Häftlingen als andere Lager.
In den 1930er Jahren wurden einzelne Homosexuelle nach verbüßter Haftzeit wieder aus dem KZ entlassen. Das bedeutete jedoch nicht, dass ihre Verfolgung endete. Nach ihrer Entlassung mussten sie sich regelmäßig bei der Polizei melden, wurden überwacht und sozial isoliert, selbst Angehörige wandten sich oftmals ab. Viele zerbrachen an dieser Nachverfolgung. Freilassungen wurden im Laufe der Jahre jedoch immer seltener und während des Krieges waren die Konzentrationslager auch für homosexuelle Häftlinge zur Einbahnstraße geworden.
Verschwundene Stimmen: Die Leerstelle der Selbstzeugnisse
Die Quellenlage zu homosexuellen Häftlingen ist außergewöhnlich schlecht. In Dachau existiert kein einziges originales Selbstzeugnis eines homosexuellen Überlebenden. Die meisten Informationen stammen aus Polizeiakten oder den Berichten anderer – oft vorurteilsbeladener – Häftlinge. Die wenigen bekannten Aussagen homosexueller Überlebender wurden erst Jahrzehnte nach dem Krieg öffentlich und waren meist anonymisiert, wie etwa im Fall von „Rolf Tischler“, der in den Veröffentlichungen der mit ihm geführten Interviews auf eigenen Wunsch ein Pseudonym verwendete.
Diese Lücke ist kein Zufall. Nach dem Krieg wagten nur wenige Betroffene, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Die fortbestehende Kriminalisierung, gesellschaftliche Ächtung und fehlende Anerkennung als Opfer machten aus dem rosa Winkel ein lebenslanges Stigma und die Betroffenen in der Geschichtsschreibung weitgehend unsichtbar.
Späte Anerkennung – langes Schweigen
In den Jahrzehnten nach 1945 wurden homosexuelle NS-Opfer systematisch ignoriert – juristisch, gesellschaftlich und erinnerungskulturell. Erst mit der Abschaffung des § 175 im Jahr 1994 (!) und der beginnenden Forschung zu Homosexuellen in den Konzentrationslagern begann auch ein vorsichtiges Gedenken. In der KZ-Gedenkstätte Dachau gibt es heute eine Tafel zur Erinnerung an die homosexuellen Häftlinge. Verloren sind jedoch die Geschichten der Opfer, die nicht wagten, zu sprechen, oder denen schlicht nicht zugehört wurde.
Das Gedenken an homosexuelle NS-Opfer ist das Ergebnis jahrzehntelanger Kämpfe: gegen staatliche Ignoranz, gegen fehlende Aufarbeitung in den Archiven, gegen kollektives Verdrängen. Nun, da sich Interesse an diesem Thema zeigt, sind viele der Betroffenen bereits verstorben. Anerkennung oder Entschädigung haben sie nie erhalten. Sie blieben mit ihrem Trauma völlig allein, wurden auch in der BRD und der DDR ausgestoßen. Für viele ging mit den psychischen und körperlichen Folgen der KZ-Haft auch Verarmung einher, denn die KZ-Jahre wurden ihnen, anders als bei den im Konzentrationslager angestellten SS-Schergen, nicht auf die Rente angerechnet. Viele begingen in der Nachkriegszeit Selbstmord.
Warum diese Geschichte heute zählt
Die Verfolgung homosexueller Männer im Nationalsozialismus ist kein „Randthema“. Sie zeigt, wie ein autoritäres Regime mit Minderheiten umgeht. Und sie ist auch ein mahnendes Beispiel dafür, wie lange ein Staat braucht, um Unrecht zu benennen – wenn er es überhaupt tut. Sowohl die BRD als auch die DDR hatten kein Interesse an der Aufarbeitung der an Homosexuellen begangenen Verbrechen, da Homophobie auch nach der NS-Diktatur Normalität blieb.
Die Lebensgeschichten von Johann Krumm, Leopold Obermayer und den vielen anderen homosexuellen KZ-Opfern sind jedoch keine Fußnoten. Sie sind Teil unserer Geschichte – und ihrer Nachwirkungen, die bis heute zu spüren sind.
Noch immer erleben queere Menschen Ausgrenzung, Gewalt und politische Angriffe. Nationalsozialistische Stereotype, die Homosexualität in der Propaganda etwa als jugendgefährdend, unrein, ansteckend und bedrohlich inszenierten, wirken teilweise bis heute nach. Deshalb ist das Gedenken an homosexuelle KZ-Häftlinge nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein Appell für die Gegenwart: Für ein solidarisches Erinnern. Und gegen das Vergessen.
Literaturauswahl zum Weiterlesen
- Eschebach, Insa: Homophobie und Devianz. Weibliche und männliche Homosexualität im Nationalsozialismus, Berlin 2012.
- Jellonnek, Burkhard/Lautmann, Rüdiger (Hrsg.): Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle. Verdrängt und ungesühnt, Paderborn u. a. 2002.
- Jellonnek, Burkhard: Homosexuelle unter dem Hakenkreuz. Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich, Paderborn 1990.
- Knoll, Albert: Totgeschlagen – Totgeschwiegen. Die homosexuellen Häftlinge im KZ Dachau, München 2000.
- Mußmann, Olaf (Hrsg.): Homosexuelle in Konzentrationslagern. Vorträge, Bad Münstereifel 2000.
- Schwartz, Michael (Hrsg.): Homosexuelle im Nationalsozialismus. Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, München 2014.
- Zinn, Alexander (Hrsg.): Homosexuelle in Deutschland 1933–1969. Beiträge zu Alltag, Stigmatisierung und Verfolgung, Göttingen 2020.
- Zinn, Alexander: „Aus dem Volkskörper entfernt“? Homosexuelle Männer im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 2018.
- Zur Nieden, Susanne (Hrsg.): Homosexualität und Staatsräson. Männlichkeit, Homophobie und Politik in Deutschland 1900–1945, Frankfurt am Main 2005.