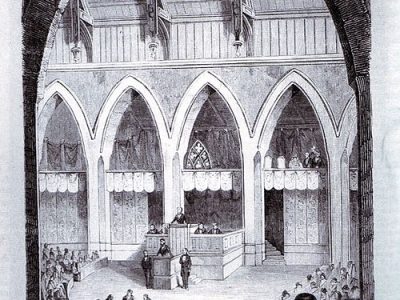„Unberührte Natur“ in den westlichen USA ist keineswegs nur der Zustand der Gebirge, Ebenen und Wälder vor Ankunft der Europäer. Dabei ist es unerheblich, ob dieses Datum mit 1492 gleichgesetzt wird oder ob man die Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert oder die Ankunft der Amerikaner im Westen der heutigen USA im 19. Jahrhundert als Ende des paradiesischen Zustands der Rocky Mountains nimmt. Hinter dem Bild der unberührten Natur steht oft noch die Vorstellung vom „Edlen Wilden“, die auf Herder und die Philosophen der Klassik und Romantik des 18. und 19.Jhs. zurückgeht.
„Unberührte Natur“ in den westlichen USA ist keineswegs nur der Zustand der Gebirge, Ebenen und Wälder vor Ankunft der Europäer. Dabei ist es unerheblich, ob dieses Datum mit 1492 gleichgesetzt wird oder ob man die Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert oder die Ankunft der Amerikaner im Westen der heutigen USA im 19. Jahrhundert als Ende des paradiesischen Zustands der Rocky Mountains nimmt. Hinter dem Bild der unberührten Natur steht oft noch die Vorstellung vom „Edlen Wilden“, die auf Herder und die Philosophen der Klassik und Romantik des 18. und 19.Jhs. zurückgeht.
Neuere Forschungen von Evolutionsforschern, Archäologen, Historikern, Geographen u.a. zeigten aber, dass schon vor mindestens 11000 Jahren in Amerika kein „natürlicher Zustand“ mehr existierte! Zu diesem Zeitpunkt starben zahlreiche Großsäuger aus. 39 Gattungen vom Riesenfaultier bis zum Mammut starben damals offensichtlich aufgrund intensiver Bejagung aus. Die Forschungen zeigten, dass die vor ca.19000 Jahren eingewanderten Indianer zu diesem Zeitpunkt eine Kulturstufe erreichten („Clovis“), die ihnen entsprechende Jagdmethoden ermöglichten!
Die Clovis-Kultur zeichnet sich durch exakt gearbeitete Pfeil- und Speerspitzen aus, d.h. die damaligen Indianer besassen bereits die wirkungsvollen Distanzwaffen Bogen und Speerschleuder. Mit Schneeschuhen konnten die Indianer im Winter ihre Beute mühelos einholen, und die ebenfalls damals schon gezähmten Jagdhunde waren wertvolle Jagdhelfer. Die Jäger nutzten spezifische Verhaltensweisen der Beutetiere aus. Wird beispielsweise ein Elch angegriffen, flieht er nicht, sondern verteidigt sich. Bei einem Hirsch dagegen sollte sich der Jäger tunlichst erst möglichst spät zeigen, denn dieser wird fliehen – im gübstigsten Fall genau in eine klug aufgestellte Falle. Doch nicht jedes Beutetier war gleich begehrt: Am liebsten jagten die Indianer Grosstiere, denn die lieferten enorme Fleischmengen und dazu gewann der Jäger, der ein Mammut erlegte, unvergleichlich mehr Ansehen als ein anderer Jäger, der mit einem Hasen nach Hause kam. Für entsprechend wertvolle Beute kann es sich der Mensch leisten, auch dem letzten existierenden Exemplar nachzujagen. Das unterscheidet ihn von tierischen Jägern, die mit ihrer Beute sehr viel nachhaltiger umgehen. Durch Arbeitsteilung und ein breitgestreutes Nahrungsspektrum hatte der Mensch der späten Eiszeit einen Energieüberschuss zur Verfügung, der ihn zu kulturellen Leistungen befähigte. Schon die frühen Indianer konnten also ihre Umwelt massivst beeinflussen!
Abgesehen von den kulturgeschichtlichen Aspekten haben diese Erkenntnisse aber auch ganz konkrete Folgen für das moderne Management von Naturparks. Hinsichtlich Zahl der Tiere, des Artenspektrums und der Rolle der Feuer in Parks wie dem Yellowstone-Park ergeben sich weitreichende Konsequenzen. Bis in die jüngste Zeit vertrat der Park Service den Standpunkt, dass 12000 – 15000 Wapitis, einen unseren europäischen Rothirschen nah verwandte Art, im Gebiet des Yellowstone-Parks normal und nicht schädlich sei. Neueste Forschungen zeigten aber, dass Weiden, Espen und sogar Kiefern Frassschäden durch die Hirsche haben. Dadurch sind in dem Gebiet die Biber nahezu ausgestorben. Das heisst aber, dass es früher bedeutend weniger Wapitis gegeben haben muss, denn schließlich haben im Yellowstone-Gebiet früher Unmengen von Bibern ihr Auskommen gefunden!
Es gibt tatsächlich verschiedene Hinweise, daß bis ins 19. Jahrhundert bedeutend weniger Wapitis in der Region lebten: Waldläufer und Entdecker des 19.Jahrhunderts berichteten kaum über Wapiti-Sichtungen. Früher konnten sich auch die Indianer im Winter von Beeren und Früchten ernähren, was heute nicht mehr möglich wäre, da die Büsche und Sträucher kaum noch Früchte tragen und ausserdem heute viel kleiner sind (50cm) als früher (2m). Zur niedrigeren Gestalt der Büsche kommt der durch Huftierfraß hervorgerufene Krüppelwuchs. Da sich die Indianer fürher aus diesen Büschen wegen des harten Holzes und geraden Wuchses Material für Pfeile holten, muss dieser Krüppelwuchs eine relativ junge Erscheinung sein. Nur in den Pufferzonen zwischen den Stammesgebieten konnten sich fürher die Wapitis in nennenswerten Stückzahlen halten – obwohl sie hier von Wölfen bejagt wurden. Das zeigt, dass die Indianer der regulierende Faktor waren.
Auch die Ergebnisse archäologischer Ausgrabungen stimmen exakt in dieses Bild: Würden die heutigen Zahlen des Wapitibestandes den historischen und prähistorischen Verhältnissen entsprechen, müssten Hirschknochen in archäologischen Fundstätten dominieren. Da dies nicht der Fall ist, müssen die Stückzahlen mindestens während der letzten 10000 Jahre sehr klein gewesen sein. Dass die trotzdem gefundenen Wapitiknochen eine spezifische Alters- und Geschlechtsstruktur aufweisen, weist darauf hin, dass diese Tiere gejagt wurden und nicht als Aas in die Lager gebracht wurden.
Die unvoreingenommene Erforschung der indianischen Kulturen erbrachte ein Bild des Indianers, das so gar nicht zur romantisch-verklärten Figur eines Winnetou passen will: Die Indianer hatten offensichtlich keinerlei Bestrebungen, die Natur zu schützen. Auch ihre Religion bietet dazu keine Anhaltspunkte: Gingen die Zahlen der Wapitis in ihrem Jagdgebiet zurück, war für Indianer der „Zorn der Geister“ die Ursache, nicht Überjagung! So wurde oft beobachtet, dass um einen Siedlungsplatz die Natur übernutzt war. Dieses Bild treffen die Forscher nicht nur bei den relativ primitiven Jägerkulturen in Nordamerika an, auch die Städte von der Anasazi in Arizona, der Maya in Yucatan oder der altmexikanischen Kulturen wie Teotihuacan wurden offenbar in erster Linie deshalb verlassen, weil ihre Umgebung die grosse Stadtbevölkerung nicht mehr ernähren konnte.
So makaber es klingen mag, der Grund für den Anstieg der Zahl der Huftiere in Nordamerika seit ca. 500 Jahren ist offenbar alleine der rapide Bevölkerungsrückgang um 50-90% unter den Indianern, die den eingeschleppten Krankheiten der Europäer keine Abwehrkräfte entgegensetzen konnten oder wie Tiere von der amerikanischen Armee abgeknallt wurden.
Ähnliches wie für die Großtiere gilt offenbar auch für die Feuer im Yellowstone-Park. Nach der bisherigen Theorie wurden Feuer im Yellowstone-Park überwiegend durch Blitzschläge verursacht. Die meisten Blitzschläge ereignen sich jedoch in Zeiten, wenn die verbreitesten Baumarten des Parks wie Espen schwer entzündbar sind. Daraus folgt, dass die Feuer hautpsächlich durch Indianer entfacht wurden, die damit das Unterholz abbrannten, um ihre Jagdmöglichkeiten zu verbessern und den Boden zu düngen.
Die Folgen für das Park-Management sind klar: Die bisherigen „Hands-off“-Theorien, die danach trachteten, der Natur ihren freien Lauf zu lassen, müssen das „indianische Land-Management“ berücksichtigen. Nach den verheerenden Megabränden während der letzten Jahre, verursacht durch übergrosse Anhäufung von trockenem Unterholz, bemüht sich die Parkverwaltung jetzt, gezielt Brände zu legen und so das Verhalten der Indianer zu imitieren. Und die Touristen müssen Abschied nehmen von den Hirschherden, die so romantisch anzusehen sind. Das Ökosystem Yellowstone braucht niedrige Wapitizahlen, um natürlich funktionieren zu können.
Was für Yellowstone gilt, trifft natürlich auch außerhalb der Vereinigten Staaten zu. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Hier allerdings ist man bereit, großflächige Zerstörungen in Kauf zu nehmen, um dem Park sein wirkliches natürliches Gepräge wiederzugeben. Würde man Feuer und Borkenkäfer bekämpfen, bekäme man doch nur wieder einen Wald, der dem Zustand des Mittelalters entspricht: Der im 19. Jahrhundert so verklärt dargestellte „deutsche Wald“ war damals durch dauernde Holzentnahme, Holzkohlegewinnung, Waldweide und viele andere Arten intensiver Nutzung so degeneriert, daß sich einzelne Waldbesitzer wie die Reichsstadt Nürnberg gezwungen sahen, besondere Schutz- und Pflegemassnahmen festzulegen – der Beginn der modernen Waldwirtschaft.