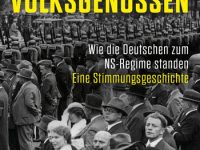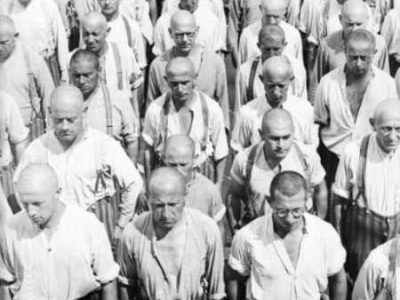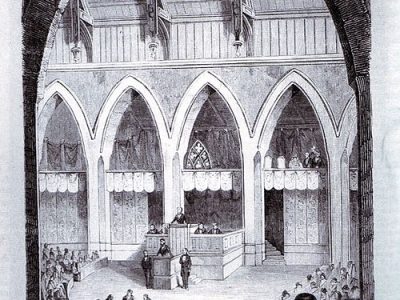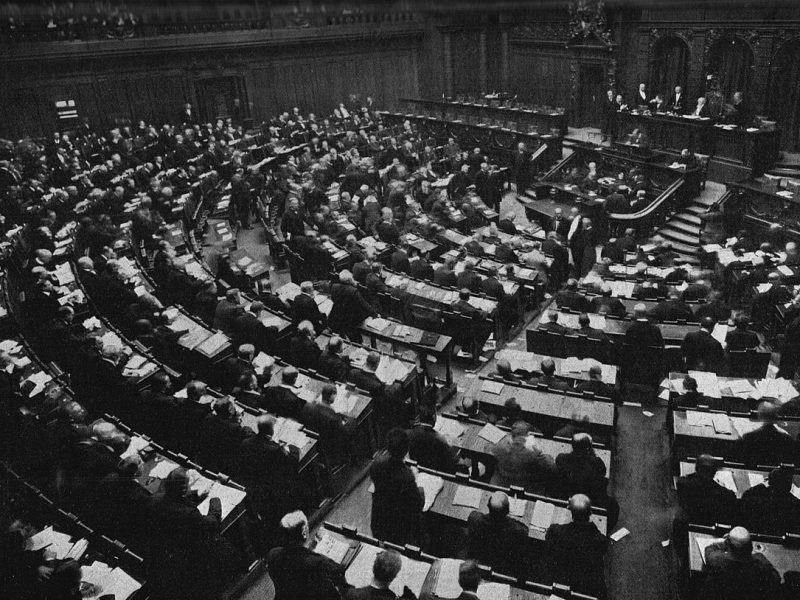Im minoischen und kleinasiatischen Kulturbereich muss es mehrere mächtige Göttinnen gegeben haben. Eine davon war Hera.
Die alte (vorgriechische?) Mondgöttin Hera wurde etwa zur Gattin des Göttervaters Zeus „degradiert“ – ihr andauernder Zorn auf Zeus mag von dieser Vorgeschichte herrühren, ganz zu schweigen davon, dass sie als Beschützerin der Ehe von Natur aus eine Gegnerin des Dauer-Ehebrechers Zeus sein musste.
Auch einen Fruchtbarkeitsaspekt muss die „alte“, vorgriechische Hera gehabt haben: In Argos, einer der ältesten Städte Europas (!), gab es die Sage, dass die Stadtgöttin Hera (Hera laut wikipedia übrigens die weibliche Form von heros = Herr!) hier alljährlich in einer Quelle gebadet und so ihre Jungfräulichkeit immer wieder erneuert habe.
Zeus hat sich übrigens – wie mit vielen anderen Frauen – auch mit Hera nur durch eine List vereinen können: Er verwandelte sich in einen Kuckuck (ein Symbol Heras und dazu ein altes Fruchtbarkeitssymbol!) und wurde von Hera in ihrem Mantel geborgen. Dort verwandelte sich Zeus zurück und „vereinigte sich mit Hera“, wie es in vornehmer Umschreibung heißt.
Im übertragenen Sinn hat Zeus also die Herrschaft der Hera an sich gerissen, indem er sich mit ihr vereinigte und nach dem Verständnis der Zeit so die Herrschaft über sie gewann.
In einer zweiten Version soll Zeus 300 Jahre um Hera geworben haben, bevor sie eine Vereinigung zuließ. Dass Zeus die Herrschaft auch über den vorgriechischen Götterhimmel erlangte, war also auch nach den alten Mythen ein langwieriger Prozess…
Bei Hera zeigt sich auch, dass der griechische Götterhimmel auch von nichtgriechischen Kulturen beeinflusst ist, nämlich v.a. von mesopotamischen Vorstellungen: Hera war ursprünglich wohl so etwas wie eine Fruchtbarkeitsgöttin, nicht notwendig anthropomorph, aber wahrscheinlich. Als solche jedoch war sie im Pantheon einigermassen unangefochten, wenn man mal davon absieht, dass es um fast jede Fruchtbarkeitsgöttin Sagen und Legenden gibt, die ihre scheinbare Machtlosigkeit und Abwesenheit während des Winters erklärt. Solche Sagen gibt´s auch von den sumerisch-mesopotamischen Fruchtbarkeitsgöttinnen. Nur ist Ishtar schon im Gilgamesch-Epos eben sowas wie Aphrodite – eine mißgünstige, neidische, eitle, hübsche Frau. Keinesfalls ist sie eine Herrscherin wie Hera.
Die zänkische, Ränke schmiedende Ehefrau des Göttervaters wurde Hera erst in mykenischer oder nachmykenischer Zeit. Zu diesem Schluss führt uns folgende Kausalkette: Die Ursprünge von Argos als von der Fruchtbarkeitsgöttin Hera beschützte Stadt gehen in vorminoische Zeit zurück; die Quellensagen aus Argos deuten ebenfalls auf sehr hohes Alter hin – Stichwort Naturgottheiten – und bei Homer, also kurz nach den „Dark Ages“ ist Hera schon die Göttergattin des Zeus.
Zwei Faktoren sind denkbar, die Hera von einer „Großen Muttergöttin“ zur Ehefrau des Göttervaters machten:
Entweder waren die Indogermanen – Mykener, Dorer – derart patriarchalisch strukturiert, dass sie sich nichts anders als die Unterwerfung der Frau unter den Mann vorstellen konnten. Diese Vorstellung des Gegensatzes zwischen indogermanisch-patriarchalischen und oriental-matriarchalischen Göttern gilt allerdings mittlerweile als überholt. Denn z.B. die Hera von Argos, eindeutig eine Herrin ohne übergeordnete Instanz, war zwar eventuell vorgriechisch, aber eindeutig nicht vorindogermanisch.
Zwischen der indogermanischen, vorgriechischen Herrscherin Hera und der klassisch-griechischen Gattin Hera liegt die Zeit des Kontakts zwischen Griechen und Mesopotamiern. In Mesopotamien war es aber üblich, dass die Göttinnen jeweils einen männlichen und ihnen überlegenen Gegenpart hatten. Die ägyptischen Gottheiten wie Isis und Osiris kamen erst viel später ins griechische Pantheon, also können die Einflüsse, die Hera derart „degradierten“, eigentlich nur von den Mesopotamiern gekommen sein.