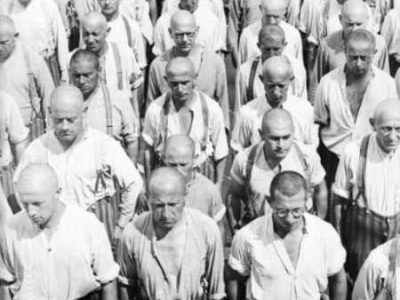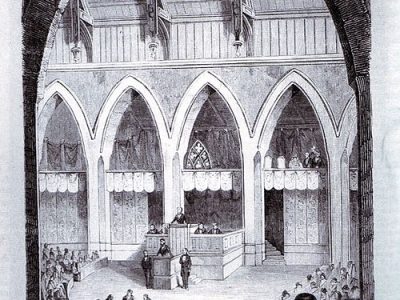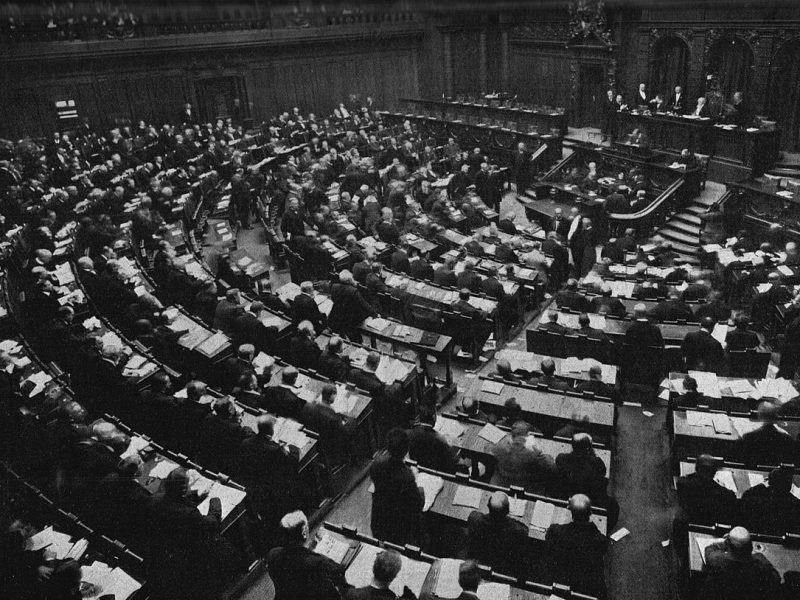1. Die KSZE/OSZE
Die auf Ergebnisse und Folgen des Zweiten Weltkriegs aufbauende KSZE-Schlussakte wurde am 1. August 1975 von 35 Staaten in Helsinki verabschiedet. Das eine politische Selbstverpflichtung der Signatarstaaten beinhaltende Vertragswerk, das mit dem 1000-jährigen Jubiläum des Mainzer Doms zusammenfiel, beinhaltete insbesondere die folgenden Themenbereiche (Verhandlungskörbe):
- Fragen der Sicherheit in Europa
- Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt
- Zusammenarbeit in humanitären Angelegenheiten und auf den Gebieten Information, Kultur und Bildung.

Der KSZE/OSZE-Prozess mit seinen vertrauensbildenden Maßnahmen zur Völkerversöhnung schuf maßgeblich mit die Voraussetzungen zum gewaltfreien revolutionären Umbruch in Europa sowie zur deutschen Einheit und bereitete zudem die Grundlage zur Erweiterung von EG/EU um zahlreiche süd- und mittel- osteuropäische Staaten.
Bei einer Analyse der damaligen Ereignisse sind auch die Mittelmeeraktivitäten der KSZE/OSZE besonders zu würdigen. Die Teilnehmerstaaten brachten zum Ausdruck, dass die Sicherheit in Europa mit der Sicherheit im Mittelmeerraum eng verbunden ist. Auf einem Expertentreffen in Valletta (Malta) im Februar und März 1979 und einem Seminar in Venedig im Oktober 1984 sprachen sie sich für gutnachbarliche Beziehungen und intensive Bemühungen im wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und Umweltbereich mit den Mittelmeerländern aus.
Sitzungsende und Abschlussbericht des Treffens in Valletta fiel gezielt mit der Unterzeichnung des Camp-David-Friedens zwischen Israel und Ägypten am 26.
März 1979 in Washington zusammen, der die Chance zur besseren Verständigung zwischen den Warschauer-Pakt-Staaten und der westlichen Welt ermöglichte.
In den siebziger und achtziger Jahren fanden zudem sehr wirkungsreiche KSZE-Nachfolgekonferenzen in Belgrad, Madrid und Wien statt. Bei der Wiener Konferenz von November 1986 bis Januar 1989 konnten bei menschlichen Kontakten und Fragen der Freizügigkeit, insbesondere bei Familienbegegnungen und -zusammenführungen, Auslandsreisen, Sportleraustausch, Städtepartnerschaften, Studenten- und Lehreraustausch, religiösen Treffen und beim Postverkehr, erhebliche Verbesserungen verabschiedet werden. Auch in den Bereichen Umweltschutz sowie Kultur und Bildung befürworteten die Vertragsstaaten ein umfangreiches Maßnahmenbündel. Das abschließende Pariser Dokument leitete mit dem Schwerpunkt „Menschliche Dimension“ eine Konferenzfolge zu dieser Thematik in Paris, Kopenhagen und Moskau in den Jahren 1989 bis 1991 ein.
Die Pariser Verhandlungen führten neben der „Glasnost“- und „Perestroika“- Politik Gorbatschows in fast allen mittel- und osteuropäischen Staaten zu der Forderung nach demokratischen Reformen und dem gesellschaftlichen Umbruch zunächst in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. In der DDR befruchteten sie maßgeblich die friedliche Revolution mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und die deutsche Einheit am 3. Oktober 1990. Dabei schuf das frei gewählte DDR-Parlament selbst die Voraussetzungen zur Auflösung der DDR und brachte seine Anregungen und Aktivitäten in die Zwei-plus-Vier-Gespräche mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs und der Bundesrepublik in den Einigungsvertrag ein.

–
Das Ende des Kalten Krieges nach der Auflösung des Warschauer Paktes führte zunächst dazu, dass das Interesse der USA an der KSZE stark nachließ. Sie präferierten die NATO und strebten an, diese so schnell wie möglich nach Osten zu erweitern. Dies stieß jedoch auf Widerstand Russlands, das aufgrund des universellen Teilnehmerkreises die KSZE und nach dessen Umbenennung zum 1. Januar 1995, die OSZE als Akteur zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa ansah.
Wegen der beharrlichen Haltung zahlreicher mittel- und osteuropäischer Staaten, der NATO beizutreten, konnte Russland jedoch nicht verhindern, dass 1997 auf dem NATO-Gipfel in Madrid Polen, Ungarn und Tschechien Beitrittsverhandlungen angeboten wurden. Im März 1999 traten diese Staaten und im März 2004 auch Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien und die Slowakei der NATO bei. In den Jahren 2017 und 2020 folgten Montenegro und Nordmazedonien als 29. und 30. NATO-Mitgliedstaaten.
Der OSZE, die sich im Wesentlichen mit der Konfliktprävention und dem Friedensaufbau in der Zeit nach Konflikten befasste und auch ein öfter genutztes Forum für den politischen und sicherheitspolitischen Dialog bot, gelang es in diesen Jahren, sich als bedeutsame Organisation zu etablieren. Dazu trugen auch etliche Wahlbeobachtungen und Friedensmissionen, u.a. eine elfjährige Langzeitmission in Kroatien, bei.
2. Der Camp-David-Frieden zwischen Israel und Ägypten

Im Anschluss an den israelisch-arabischen Sechstagekrieg von 1967 hatten alle Staaten des Ostblocks bis auf Rumänien die Beziehungen zu Israel abgebrochen und die Kontakte zu den arabischen Staaten teils auch mit Waffenlieferungen verstärkt. Nach dem Rahmenabkommen des Camp-David-Friedens vom 17. September 1978 bot die Unterzeichnung des Friedensvertrags am 26. März 1979 durch den israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin, den ägyptischen Präsidenten Mohammed Anwar al-Sadat und den amerikanischen Präsidenten Jimmy E. Carter als Vermittler eine günstige Voraussetzung zum versöhnlichen Neuanfang mit positiven Auswirkungen auf eine Ost-West-Annäherung.
Der 26. März ist auch Festtag des hlg. Liudger, der im Jahr 805 zum ersten Bischof von Münster/Westf. geweiht wurde und auch an der Gründung der niedersächsischen Stadt Helmstedt beteiligt war. Der im Stadtwappen von Helmstedt abgebildete Liudger wirkte somit in früheren Zeiten besonders engagiert im Kerngebiet des bedeutenden Grenzübergangs an der innerdeutschen Grenze zur DDR und nach Westberlin mit dem Kontrollpunkt Helmstedt und der Übergangsstelle Marienborn in Sachsen-Anhalt.
Auch die Lebensgeschichte von Johann Wolfgang von Goethe ist mit diesem Jahrestag verbunden. Am 26. März 1832 erfolgte seine Grablegung in der Weimarer Fürstengruft.
3. Die EG-Süderweiterung
Bei allen Mittelmeer-Anrainern hat der Anbau von Obst, Gemüse und Oliven, in vielen Ländern auch von Wein, eine lange Tradition und ist von erheblicher wirtschaftspolitischer Bedeutung. Auch im Erweiterungsprozess der Europäischen Gemeinschaft mit den überwiegenden Agrarländern Griechenland, Spanien und Portugal spielte ein Konsens bei diesen Produkten eine große Rolle.
3.1. Griechenland
Die griechische Kultur ist eine der ältesten, vielfältigsten und einflussreichsten Kulturen der Weltgeschichte. Mit ihr ist der Olivenbaum eng verbunden. In der Antike galt er als Symbol der Weisheit, Fruchtbarkeit und des Friedens. Zahlreiche Mythen ranken sich um die griechische Götterwelt mit ihrem Sitz auf dem Olymp, eine der bekanntesten Legenden um Athene, der Göttin der Weisheit. Bei einem von Zeus angeregten Wettbewerb mit Poseidon, dem Gott der Meere, um die Gunst des attischen Volkes, siegte sie durch die Anpflanzung eines die Ernährung der Bürger Attikas sichernden Olivenbaums und wurde dadurch zur Schutzgöttin Athens.
Mehrere große deutsche Klassiker waren Anhänger der griechischen Mythologie, z.B. Lessing mit seiner Beschreibung der Laokoon Gruppe, Hölderlin mit seinem Roman „Hyperion“ und Schiller mit seinem Gedicht „Die Götter Griechenlands“. Besonders Goethes Dichtung spiegelt eine große Begeisterung für die griechische Antike wider. Unter allen Völkerschaften haben die Griechen „den Traum des Lebens am schönsten geträumt“, heißt es in seinen „Maximen und Reflexionen“. Wen wundert es bei diesem Enthusiasmus, dass sein Drama „Iphigenie“, das sich teilweise an der „Antigone“ des Sophokles orientiert, die große Sehnsucht der Tochter des Agamemnon zum Ausdruck bringt, in das heimatliche Hellos zurückzukehren. Vorbilder für Goethe waren neben Sophokles insbesondere auch Theokrit und Homer mit seinen Epen „Ilias“ und „Odysee“. Sie inspirierten ihn zu weiteren seiner bedeutendsten Werke.
Griechenland, vor allem mit seinen gut erhaltenen Fundamenten, seiner Tradition, Musik, Sprache und seinem Essen, ist auch einzigartig für eine Synthese von Antike und Moderne. Vornehmlich die olympischen Spiele bekräftigen die weltweite Ausstrahlung der griechischen Kultur auf eine nahezu unerreichte Weise.
Auf die große Vergangenheit Griechenlands nahm der aus dem Pariser Exil zurückgekehrte Gizikis Karamanlis 1975 bezug, als er als neuer Premierminister bei dem Beitrittsantrag seines Landes zur EG vor EG-Botschaftern in Athen erklärte:
Griechenland gehört zu Europa, dessen Teil es ist gemäß seiner geografischen Lage – durch seine Geschichte und Tradition, die der Ursprung des gemeinsamen kulturellen Erbes ihrer Länder sind.
Karamanlis hatte nach der Absetzung der ab 1967 vorherrschenden Militärdiktatur eine Regierung der nationalen Einheit gebildet, der von 1974 bis 1980 die politische Wende zur Demokratie gelang.

–
Die EG-Beitrittsverhandlungen wurden vom Juli 1976 bis zur Vertragsunterzeichnung am 28. Mai 1979 geführt. Am 1. Januar 1981 wurde Griechenland das zehnte EG-Mitgliedsland. Die EG-Vertragsunterzeichnung erfolgte genau drei Monate vor dem 230. Geburtstag Goethes. Man kann nur spekulieren, ob nach den negativen Erlebnissen des Landes im Zweiten Weltkrieg mit diesem Datum eine Verbindung zu dem Poeten und dem Camp-David-Frieden hergestellt wurde, der einige Wochen vorher, am Jahrestag von Goethes Grablegung am 26. März 1979 besiegelt wurde.
3.2. Spanien

Einige Monate nach dem Tod Francisco Francos im November 1975 endete die Militärdiktatur in Spanien, die 1936 durch einen Putsch unter Führung Francos an die Macht kam. Der ebenfalls im November 1975 zum König von Spanien proklamierte Juan Carlos I. ebnete den Weg von der Diktatur zur Demokratie.
Am 6. Dezember 1978 wurde die heute noch gültige Verfassung des Königreichs Spanien in einem Referendum vom spanischen Volk ratifiziert. Sie trat einige Wochen später nach Unterzeichnung durch Juan Carlos I. am 29. Dezember 1978, dem Festtag Davids, in Kraft und regelt im Wesentlichen folgende Sachverhalte:
- Parlamentarische Erbmonarchie
- Demokratische Grundrechte und Freiheiten
- Abschaffung der Todesstrafe.
Nach dem EG-Beitrittsantrag im Juli 1977 begannen die Verhandlungen im Februar 1979 und wurden mit der Vertragsunterzeichnung am 12. Juli 1985 abgeschlossen.
Ministerpräsident Felipe González nannte nachstehende Gründe seines Landes der EG beizutreten:
- den Wunsch auf eine Konsolidierung der Demokratie
- die Hoffnung auf wirtschaftliche und soziale Modernisierung
- die als dringend notwendig erachtete Aufhebung der franquistischen Isolation und damit die Rückkehr in die internationale Gemeinschaft.
3.3. Portugal
Die sogenannte Nelkenrevolution beendete im April 1974 die Diktatur in Portugal. Nach erbitterten Machtkämpfen innerhalb der neuen Regierung insbesondere wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der portugiesischen Kolonien Mosambik und Angola erfolgten 1976 die ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen. Mario Soares als Regierungschef entließ die beiden Kolonien in der Folge in die Unabhängigkeit. Der Beitrittsantrag zur EG im Mai 1977 führte zu Verhandlungen ab 1978 und endete mit der Vertragsunterzeichnung am 12. Juni 1985 gemeinsam mit Spanien. Am 1. Januar 1986 wurden die beiden Länder das elfte und zwölfte EG-Mitglied.
Bei Portugal förderte die geostrategische Bedeutung der Azoren einen frühzeitigen Anschluss an den Westen im Ost-West-Konflikt. Das Land war Gründungsmitglied mehrerer europäischer Institutionen und am 4. April 1949 auch der NATO, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust von zwölf Staaten genau 210 Jahre nach der Uraufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“ in Washinton gegründet wurde (David Methapher).

–
4. Die EU-Osterweiterung
Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der kommunistischen Diktaturen in zahlreichen mittel- und osteuropäischen Staaten strebte man mit einer großen EU-Erweiterungsrunde eine „Wiedervereinigung des europäischen Kontinents“ an, der über Jahrzehnte durch den Eisernen Vorhang getrennt war.
Nach dem EU-Beitritt von Finnland, Österreich und Schweden zum 1. Januar 1995 bot sich die Chance, die mit der erfolgreichen EG-Süderweiterung eingeleiteten demokratischen Errungenschaften und friedens-, umwelt-, wirtschafts- und kulturpolitischen Aktivitäten auch auf Mittel- und Osteuropa in einem europäischen Binnenmarkt auszuweiten. Der Camp-David-Frieden ermöglichte es den Staaten zudem, die Aufarbeitung des Holocausts zu intensivieren und die Verständigungsbarrieren gegenüber Israel abzubauen.
Nach der Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen am 30. März 1998 wurden Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Litauen, Lettland und Estland sowie Malta und Zypern am 1. Mai 2004 Mitglieder der EU. Am 1. Januar 2007 folgten Bulgarien und Rumänien.
Bei den Verhandlungen wurden den Staaten bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Wettbewerbspolitik und dem Abbau von Grenzkontrollen längere Übergangszeiten eingeräumt. Diese Bereiche und die Höhe der Budgetzuweisungen für die Struktur-, Regional- und Landwirtschaftspolitik waren besonders umstritten, zumal die südeuropäischen Länder eine Kürzung der ihnen bisher zugestandenen Mittel ablehnten. Letzlich war eine Einigung möglich, da alle Staaten von den positiven Auswirkungen eines vergrößerten Binnenmarktes mit dem Bedeutungszuwachs im weltweiten Wirkungskreis überzeugt waren.
Nach dem Beitritt von Kroatien am 1. Juli 2013 und dem Austritt des Vereinigten Königreichs am 31. Januar 2020 umfasst die EU nunmehr 27 Mitgliedstaaten.
–
–